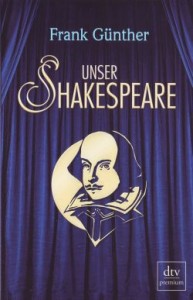Ja, es gibt einen Überdruss an Klassik. (Aber die Klassik, die zählt, befindet sich ganz woanders!)
Zu den unangenehmsten Medien-Musik-Erfahrungen befragt, würde ich – mit Blick auf die jüngste Zeit – ohne Zögern zwei nennen: den Film „Lernen von Lang Lang. Nachwuchspianist Matthias Hegemann“. Darf ich das als Irreführung eines Einzelnen und der Öffentlichkeit bezeichnen? Von Lang Lang ist nichts zu lernen.
Und die Doppelseite in der aktuellen ZEIT (29. April 2015 Seite 52f):
Das Maestro-Syndrom. Wenn die Berliner Philharmoniker am 11. Mai einen neuen Chefdirigenten wählen, werden die Grenzen zwischen Musik und Macht neu ausgelotet. Wer tritt in die Fußstapfen von Karajan, Abbado und Simon Rattle? Eine Reise zu den fünf wichtigsten Kandidaten / Von Christine Lemke-Matwey.
Ich möchte gar nicht alles abschreiben, was mich abschreckt, empfehle aber dringend, jede Zeile des langen langen Artikels nachzuschmecken, hier ein Appetizer:
Angeblich, sagen Studien, genügt Musik allein nicht mehr. Eine Musik, wie Jansons sie im Münchner Gasteig vor zwei Wochen gemacht hat, klug und ganz natürlich, indem er das Violinkonzert von Brahms (mit Frank Peter Zimmermann als Solisten) so interpretiert, als sei der alte Repertoire-Hase gerade frisch geschlachtet worden. Noch wenn die BR-Symphoniker sich in die unbelüfteten Nischen der Partitur zurückziehen, ins Räder- und Passagenwerk, bleibt man ihnen bebend auf der Spur. Diese Spannung, diese schwebenden Farben, diese Nuancen im Zwiegespräch mit der Solo-Stimme.
Vielleicht genügt genau das am Ende? In Amerika war Qualität allein noch nie das Argument. Boston, im Januar. Andris Nelsons, 36 Jahre alt und wie Jansons in Riga geboren, leitet eine Siebte Symphonie von Bruckner, vor der man auf die Knie sinken möchte: kein maskulines Quaderschieben à la Celibidache, sondern lichteste, hellste Prozessmusik …
Und wenn dann bei Gustavo Dudamel aus dem Gespräch mit der Weitgereisten statt der „avisierten 20 Minuten tête-à-tête 40 Minuten“ werden (toll!toll!toll!), „und erstaunlicherweise ist dann auch alles gesagt: zu Dvořáks Symphonie aus der Neuen Welt, die er gerade dirigiert, zu seinen Klangfantasien (‚Der Kern liegt im Espressivo‘) “ – nein danke, ich breche ab.
Ach, aber dies vielleicht noch:
Die Berliner Philharmoniker gelten als extrem selbstbewusst, ja notorisch arrogant. Die Arbeit mit ihnen, soll Rattle einmal gesagt haben, sei, als habe man Sex mit jemandem, den man partout nicht leiden könne.
Dafür hat er nun ab 2018 die britische Lady London Symphony Orchestra am Hals, womit er allerdings „von der ersten in die zweite Liga absteigt“.
Endlich beim Thema, darf ich verbal aussteigen aus dem Klassik-Karussell und auf den „Bad Blog of Musick“ verweisen, der zwei Tage vor der ZEIT schon mehr über die Nachfolge wusste. Schlagzeile: Absage! Franz Beckenbauer (113): “Ich bin zu alt für die Berliner Philharmoniker!”
Mehr davon HIER.