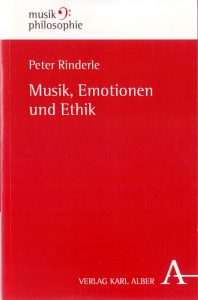Eine vorläufige Distanzierung
Eigentlich erwarte ich mir von jedem neuen Buch einen deutlichen Schritt weiter (oder sogar vorwärts, wohin auch immer), und es ist mir lästig, zugleich die Vorbehalte zu notieren, die sich bei der Lektüre bilden. Tatsächlich sind sie aber nach dem ersten (begeisterten) Streifzug durch das ganze Buch, kreuz und quer, auch mit Hilfe des Registers und des Literaturverzeichnisses (was hat der Mann wirklich gelesen und zitiert, was führt er nur an, um Belesenheit zu zeigen?), ständige Begleiter, die manchmal vortreten und mir ins Ohr flüstern: du kannst es beiseitelegen, du verlierst viel Zeit, um dich auf den gleichen Stand zu bringen und ganz am Ende doch – ohne Lerneffekt – zu distanzieren.
Die Verbindung von Musik und Moral in einer Problemstellung ist mir ohnehin suspekt, und erst die scheinbare Häufung in verschiedenen Büchern, auch von hochgeachteten Autoren, erzeugt eine Bereitschaft, an die Dringlichkeit der Sache zu glauben, probeweise, – das Wort „glauben“ fällt mir schwer. Musterfall Martin Seel, dessen „Ästhetik der Natur“ ich im Portugal-Urlaub 2011 als Nonplusultra wiederentdeckt hatte, jetzt mit ernsten Zweifeln erneut durchblättere, nachdem einiges im neuen Buch „Macht des Erscheinens“ völlig unakzeptabel erscheint, nicht nur die Rolle der Musik, sondern auch die Gedanken zu Botho Strauß, – Verdacht eines verkappt erzkonservativen Denkens. Vielleicht ansetzend bei der Seel-Kritik im Buch von Rinderle, das mir aber selbst immer kritikwürdiger erscheint, zunächst in bestimmten Details, Unwesentlichkeiten, dann in der gesamten Problemstellung. Beginnen wir mit Nietzsche, auf dem rückwärtigen Einband:
Peter Rinderle: Musik, Emotionen und Ethik / Karl Alber Freiburg München 2011
So hat es Nietzsche nicht gemeint! möchte ich ausrufen. Aber soll ausgerechnet ich einem Philosophen darüber etwas erzählen? Und dann lese ich noch einmal (auf Seite 17) ein Nietzsche-Zitat:
Die reale Intention des Künstlers oder der empirische Einfluß eines Kunstwerkes auf den Rezipienten könnten also die ethische Bedeutung von Kunst bestimmen. So berichtet Friedrich Nietzsche im Fall Wagner (…) über seine Begegnung mit Bizets Oper Carmen: „[…] ich werde ein besserer Mensch, wenn mir dieser Bizet zuredet. Auch ein besserer Musikant, ein besserer Zuhörer.“ Ein Musikstück kann zweifelsohne bestimmte empirische Wirkung entfalten, und diese Wirkung kann dann auch moralisch bewertet werden.
Darf man so harmlos Nietzsche zitieren und deuten? Als sei Nietzsche so naiv gewesen? Als gehe es ihm um die ethische Bedeutung von Kunst? Als rede er nicht nur in Gleichnissen und Annäherungen oder Entfremdungen, wie überhaupt im Fall Wagner. Als habe er nicht im Klartext unendlich viel differenzierter über eine neue Moral, über Selbstäuschung, Bewertung und Umwertung geschrieben? Und müssen wir nicht wenigstens versuchen, ähnlich differenziert und skeptisch über solche Fragen nachzudenken? Ein Beispiel:
Auch wenn Kunst kein ethisches Therapeutikum mit Wirkungsgarantie zu sein vermag, keine Schule der Moral, so ist ihr doch eines eigen: Sie besitzt einen bereichernden Charakter. Kein Künstler tritt an, um die Welt so zu belassen, wie sie ist. Auch wenn er sich nicht anmaßen möchte, sie tatsächlich verändern zu können, will er doch gestaltend auf sie einwirken. (…)
Was das gute Leben sei, für den Einzelnen wie für die Gemeinschaft, kann die Kunst nicht wissen. Wenn aber das schlechte Leben eines wäre, in dem die Welt leer erscheint, farblos und taub, verschlossen und abweisend, eine Welt, in der sich der Einzelne nicht gesehen, nicht anerkannt und überflüssig wähnt, in der also die Weltbeziehung verarmt oder erkaltet, könnte die Kunst ein Gegenbild bieten.
Quelle Hanno Rauterberg: Die Kunst und das gute Leben Über die Ethik der Ästhetik / edition suhrkamp Berlin 2015 (Seite 200 f)
Und Rauterberg zitiert in genau diesem Zusammenhang den vorhin genannten Philosophen (Ethisch-ästhetische Studien, Frankfurt/Main 1996 S.15):
Kunstwerke sind für uns gerade deswegen von Interesse, weil die Begegnung mit ihnen unser Selbstverhältnis erweitert, in gewisser Weise sogar bricht. Sie versetzen uns in ein besonderes Welt- und Selbstverhältnis, schreibt der Philosoph Martin Seel.
Rinderle dagegen scheut sich nicht, ohne jede Ironie Ästhetik und Gerüchteküche zu vermengen (a.a.O. Seite 18):
Handelte der Maler Paul Gauguin nicht unmoralisch, als er seine Familie verließ, um sich auf Tahiti, umgeben offenbar von vielen hübschen Mädchen, nur noch seiner Kunst zu widmen?
Ein kurzer Blick ins „Noa Noa“ hätte den Autor auf andere Gedanken bringen können:
Erst im Innern der Insel, in engster Berührung mit dem Leben der Eingeborenen, fand Gauguin, was er im kranken Europa vergeblich gesucht hatte: seinen „neuen Menschen“, den er von nun an zum eigentlichen Gegenstand seiner Kunst machte. Und von diesem Menschen, der mit der Sprache eines Kindes zu ihm sprach, erfuhr er, „daß ein Künstler etwas Nützliches ist“.
Quelle Paul Gauguin: NOA NOA / Mit einem Nachwort von Kuno Mittelstädt / Henschelverlag Berlin 1958 / Zitat K.M. Seite 136
Hanebüchen wird es, wenn Rinderle sich einige Seiten weiter mit den Inhalten des Begriffs „Musik“ befasst, willkürlich einige Musiker bzw. Musikwissenschaftler herausgreift und von hohem Ross herab beurteilt:
Viele Komponisten kennen keine philosophischen Skrupel und sind erfrischend unbekümmert.
Seine Beispiele sind Stockhausen und Rihm, die er aber nicht im Original, sondern nach Eggebrecht zitiert, um dann, wie er sagt, eine „schöne“ Definition von Marcel Duchamp anzufügen, als habe dieser in Sachen Musik irgendeine Bedeutung. Es ist wohl nur als Gag gemeint, jedenfalls fährt er selbst „erfrischend unbekümmert“ fort:
Manche Musikwissenschaftler muß man im Vergleich dazu als übervorsichtig und denkfaul, wenn nicht gar als feige bezeichnen.
Womit er offensichtlich Carl Dahlhaus, Christian Kaden und Hans Heinrich Eggebrecht meint. Auch Claus-Steffen Mahnkopf wird von diesem Autor nicht geschont. Wir sollten deshalb versuchen, so sagt er,
sowohl die Skylla des Fundamentalismus mancher Komponisten („Allein meine eigene Musik ist wirklich Musik!“) als auch die Charybdis des Relativismus vieler Musikwissenschaftler („Die Vorstellungen von Musik sind zu unterschiedlich, als daß man sie auf einen einzigen Nenner bringen könnte!“) zu umschiffen, und uns um eine undogmatische und offene Analyse des Begriffs „Musik“ bemühen, die dennoch den Anspruch einer allgemeinen Reichweite ihres Ergebnisses nicht scheut.
Und ich bin in größter Versuchung, den Kahn der undogmatischen Philosophie ein wenig zurückzusetzen und dieses Buch, in dessen Gewässern ich schon eine Weile umhergekreuzt bin und mit dem ich – gleich Odysseus auf der Insel Aiaia – noch viel Zeit verbringen wollte, großzügig zu umschiffen.
Ich will allerdings nicht verschweigen, dass der Autor schließlich doch zu einer akzeptablen Definition des Begriffes „Musik“ kommt, die er von Jerrold Levinson und Rainer Cadenbach ableitet. Demnach ist Musik 1. ein hörbares Phänomen, ihre Materialien sind Klänge, und diese Klänge erscheinen uns um ihrer selbst willen interessant. 2. handelt es sich um „zeitlich organisierte Klänge, für die wir uns um ihrer selbst willen interessieren“ , was sie z.B. von gesprochener Sprache unterscheidet, soweit deren Klangfolge etwa durch eine schriftliche Mitteilung ersetzbar wäre. 3. wird sie (die Musik) von Menschen gemacht, die „das jeweilige Klangmaterial auf eine bestimmte Art und Weise formen und organisieren“ und sie wird „von Menschen auf eine bestimmte Art und Weise wahrgenommen und rezipiert“ , zumal Musik wesentlich immer auch auf Kommunikation angelegt ist.
Nebenbei stößt man immer wieder auf Fallgruben von Sätzen wie dem folgenden, der unmittelbar nach einer Warnung vor pauschalen und voreiligen Urteilen zu lesen ist (Seite 30):
Es gibt auf der einen Seite gute Rocksongs von den Rolling Stones, Jimi Hendrix oder Deep Purple sowie wunderbare Jazzimprovisationen von Dexter Grodon, Sonny Rollins oder Branford Marsalis, und auf der anderen Seite gibt es unverständliche und sterbenslangweilige Avantgarde-Kompositionen, die wirklich keinen besonderen ästhetischen Wert für sich in Anspruch nehmen können.
Beteuerungen, die „aus dem hohlen Bauch“ kommen und schlimme Befürchtungen erwecken, wenn gleichzeitig der Gefühlswelt des Rezipienten ein besonderer Rang zugesprochen wird, – abgestützt durch eine Theorie, die nicht zufällig aus der Feder eben dieses Autors Rinderle stammt (Seite 33). Er ist der Meinung, dass
sich die Expressivität von Musik als das Resultat der ein- und mitfühlenden Imagination des Hörers, d.h. als das Produkt der emotionalen Phantasie eines aufmerksamen Rezipienten verstehen läßt. Der Hörer stellt sich dieser Auffassung zufolge eine mehr oder weniger deutlich individuierte Person vor, die ihre Emotionen in dem betreffenden Musikstück zum Ausdruck bringt. Das ist der Kerngedanke der sogenannten Persona-Theorie der musikalischen Expressivität (vgl. Rinderle 2010 5. Gesten einer imaginären Person …), bei der die Phantasie des Hörers eine zentrale Bedeutung hat. Obwohl die emotionale Erregung oder Assoziation des Hörers nicht die Grundlage der Zuschreibung von expressiven Eigenschaften bilden, ist eine emotionale Resonanz beim Hörer dennoch eine wichtige Begleiterscheinung bei der Wahrnehmung expressiver Musik (vgl. Rinderle 2010, 6. … und emotionale Antwort des Hörers). Die expressiven Eigenschaften eines Musikstücks sind nicht nur beliebige Eigenschaften, die wir zur Kenntnis nehmen können oder auch nicht, sondern tragen zum Verständnis und zum ästhetischen Wert eines Musikstücks bei. Und wenn dessen ästhetische Vorzüge unter anderem von seinen ethischen Eigenschaften abhängig sein können, dann gibt es auch eine Interaktion der ethischen und ästhetischen Dimensionen von Musik (vgl. Kapitel 2).
Es ist genau dieser Punkt, an dem ich meine Lektüre des Buches aus emotionalen Gründen abbrechen möchte, ohne mich zu einer langatmigen und möglicherweise sterbenslangweiligen Begründung bereitzufinden.
Quelle der Zitate Peter Rinderle: Musik, Emotionen und Ethik / Karl Alber Freiburg München 2011 (Seite 22 f, 30 und 33)
Zurück zum Anfang! Ein paar Seiten aus Rüdiger Safranskis Buch über „Das Böse“ würden genügen, sich über diese kleinbürgerliche Rezipienten-Sicht zu erheben und an radikaleren Geistern zu üben, an Nietzsche zum Beispiel:
Er hatte die künstlerische Praxis zum Paradigma des gelingenden Lebens erhoben und ihr jenen Ort zugewiesen, der einst der Religion vorbehalten gewesen war. Kunst war für ihn das Gegengewicht zur utilaristischen Entzauberung der Welt. Nietzsche hatte die Künstler und Lebenskünstler zum einem überschwenglichen Autonomiebewußtsein ermuntert. Das „L’art pour l’art“ sollte nicht nur für die Kunst, sondern für das ästhetisch gestaltete Leben selbst gelten. Der ästhetische Mensch hat nach Nietzsche geradezu die Pflicht zur Rücksichtslosigkeit. Er soll sich nicht durch Mitleid und durch das davon abgeleitete Bewußtsein der sozialen Verantwortlichkeit herunterziehen und schwächen lassen. Er ehrt vielmehr die Menschheit, indem er sich selbst zur Persönlichkeit formt, und nicht dadurch, daß er Solidarität mit den „Allzuvielen“ übt. Ausdrücklich setzt Nietzsche den ästhetischen Menschen in einen Gegensatz zum moralischen. Wenn er behauptet, die Welt sei nur als „ästhetisches Phänomen“ gerechtfertigt, bedeutet das: Ihr Sinn liegt darin, daß sich das Leben in einigen gelungenen Exemplaren aufgipfelt. Nicht das Glück und Wohlergehen der größtmöglichen Zahl, sondern das Gelingen des Lebens in einzelnen Fällen ist der Sinn der Weltgeschichte.
Quelle Rüdiger Safranski: Das Böse oder Das Drama der Freiheit / Fischer Taschenbuch Frankfurt am Main 1999 (Seite 238)
Ich sage nicht, dass ich mich für diesen imaginären Künstler begeistere. Kann man im Fall Mozart von einem „Gelingen des Lebens“ reden? Oder vielmehr von einem Gelingen seines Werkes? Auch und gerade des Don Giovanni? Und möchte man einen Rinderle darüber abwägen lassen?