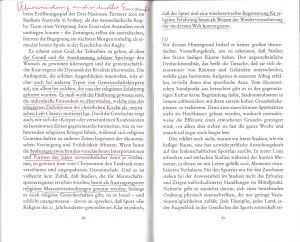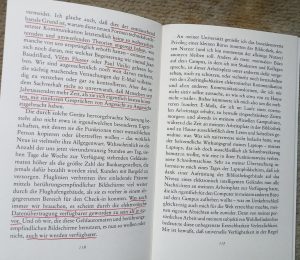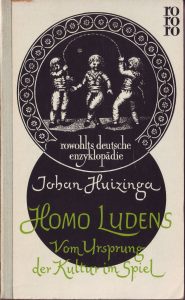Ein Drama – vergleichbar oder nicht?
 HIER anklicken! Vorfahren auf 16:39!
HIER anklicken! Vorfahren auf 16:39!
NIEDERSCHRIFT (JR)
(16:39) Barbara Bleisch: Was findet man auf dem Fußballfeld, was Sie im Orchestergraben nicht finden?
Daniel Barenboim (lacht laut): Soll man nicht vergleichen. Das soll man nicht vergleichen, nein. Ja man hat soviel gemacht, ja ein Dirigent ist wie ein Trainer, beim Fußball, ehhh, nein, man soll das nicht vergleichen, das sind zwei total unterschiedliche Dinge, und der Dirigent ist nicht wie der Trainer, in dem Moment, wo die Mannschaft spielt, hat er seine Arbeit gemacht und kann nichts mehr tun, der Dirigent kann Gottseidank im Konzert noch etwas bewirken, also ist er wie ein Regisseur, in der Oper oder im Theater, (richtig, da stimmt’s) die Regisseure haben es sehr schwer, die arbeiten wochenlang, in der Oper, im Theater manchmal monatelang, und dann kommt die Generalprobe, und dann ist AUS. Dann sind sie geliefert, was die Sänger oder Schauspieler machen, sie können das nicht mehr beeinflussen, sie können alles vorprogrammieren, aber dann …, ich kenne auch ganz große Regisseure, die nie in die Premieren gegangen sind, nicht, wie man denken könnte, weil sie unsicher waren oder weil sie wollten nicht sehen, wie das Publikum reagiert, sondern dieses Gefühl von Nichts-mehr-tun-können , diese Impotenz, diese reaktive (kreative?) Impotenz, die Arbeit war schon gemacht und jetzt sind die Leute geliefert und sie, diese Regisseure, sind abhängig davon, von dem Willen und den Möglichkeiten eh eh der Schauspieler oder Sänger. Der Dirigent ist auch ein bisschen so, ich meine, ich kann ja als Dirigent eine sehr klare Idee haben, wie ich eine bestimmte Phrase in der Oboe mir vorstelle, aber wenn der Oboist entweder nicht in der Lage ist, so zu spielen, oder er will nicht, oder fühlt es anders …., kann ich nichts tun. Man spricht immer von der Macht der Dirigenten, des Dirigenten, der Dirigent hat keine Macht, der Dirigent kann bestimmen, vielleicht, manchmal, wann das Konzert anfangen soll und Zeichen geben, wie laut oder leise das gespielt (wird), aber das Orchester – das dürfen weder die Dirigenten noch die Orchestermusiker vergessen – die Töne, die Musik wird vom Orchester gemacht. Der Dirigent kann soviel wirken und tun und so … aber es ist wichtig, dass sie das nicht vergessen, dass es sind die Orchestermusiker, die wirklich das musizieren und die Töne spielen, dass es gut ist für das Ego des Dirigenten kleinzuhalten, aber die Orchestermusiker müssen auch daran denken, weil sonst reagieren sie nur, sie müssen agieren, da sie spielen, müssen sie agieren, und deswegen ist es sehr wichtig, daran zu denken, dass es sind die Musiker im Orchester, die spielen. (Aber Sie bleiben ja mit dem Orchester auf der Bühne, sie sind nicht wie der Trainer, der dann nur am Rand steht.) Genau! (20:07)
ENDE DES ZITATES
Und was sagen Sie?
Ich finde den Vergleich sehr anregend. Genau so wie den Vergleich zwischen dem Drama auf der Theaterbühne und im Leben. Und es ändert sich, sobald ich von Performance spreche. Oder von Ritual.
Mir scheint, dass es was bringt, die Rollen der Mitwirkenden auf beiden Seiten ganz naiv durchzusprechen, damit die Unterschiede klar zutage liegen, die sonst nur „selbstverständlich“ sind.
Natürlich, ein Fußballspieler, der spielt, der eine Rolle spielt, ist erledigt. Außer er spielt trotzdem effektiv (macht Tore). Schön sein hilft hier noch weniger als nur schön spielen: es macht den Spieler lächerlich. („Du hast die Haare schön, du hast die Haare schön!“)
Aber in dem Film über Karajan gestern haben wir mit Interesse auch die Wellen seiner Fönfrisur betrachtet und mussten lachen, als plötzlich der Friseur als Zeitzeuge im Bild auftauchte (ohne dass die Frisur zum Thema wurde). TITEL-ZITAT:
Bewegendes Karajan-Filmporträt von Robert Dornhelm
Ein außerordentlicher Abend für einen außerordentlichen Mann. Anlässlich des bevorstehenden 100. Geburtstags von Herbert von Karajan (*5. April 1908) feierte Robert Dornhelms feinfühliges Filmporträt „Karajan oder Die Schönheit wie ich sie sehe“ in der Wiener Staatsoper Premiere. 2010 (!) s.a. HIER.
Übrigens habe ich aus Karajans großer Zeit deutlich in Erinnerung, wie seine filmtechnische Ästhetik analysiert wurde: er setze die Instrumente seines Orchesters gern so in Szene, als spielten sie von selbst (der Trichter und die Windungen des Horns, allenfalls die Finger auf den Ventilen). Auf die Frage, warum er die Musiker ausklammere (die Hauptrolle übernahm sein eigenes Gesicht – vornehmlich mit geschlossenen Augen – und die alles lenkenden Hände) sagte er (zumindest sinngemäß): sie sind zu hässlich. Ich erinnere mich daran so genau, weil es mir später als Äußerung eines Fernsehregisseurs (beim Domplatzfestival in Köln) auffiel: „der singende Mensch ist nicht ästhetisch!“ Es war die gleiche Zeit, als der junge Kevin Volans in einer unserer Radiosendungen zum erstenmal die Technik der Weichzeichnung in Karajans Tonaufnahmen beschrieb: man hört die Einsätze nicht, den „Glottisschlag“. (Zu Volans im WDR damals siehe auch – im letzten Teil- hier.)
***
In dem immer wieder lesenswerten Buch von Gunter Gebauer „Poetik des Fussballs“ (Campus Verlag Frankfurt New York 2006) finde ich kein Kapitel über den Trainer (so dass ich seine Rolle mit der des Dirigenten oder des Regisseurs vergleichen könnte). Ich beschränke mich auf ein allgemeineres Zitat, das aber auch – trotz des hochfliegenden Wortes „Poetik“ im Buchtitel – heilsam ernüchternd wirkt:
Die Poesie des Fußballs entsteht nicht aus einem freien Spiel der Einbildungskraft, sondern ist an einen Standpunkt gebunden. Sie ist parteiisch und wirkt unmittelbar auf ihre Liebhaber. (…)
Auch wenn Fußball von Menschen gespielt wird, entsteht seine Poesie nicht durch menschliche Handlungen allein. In die unvergesslichen Spiele mischt sich etwas ein, was über Menschen hinausgeht. Der Zufall lässt unfassbare Dinge entstehen: übermenschliches Gelingen, aber auch unbegreifliches Versagen. Eine geheimnisvolle Dramaturgie kann einen Spielverlauf hervorbringen, der die menschliche Phantasie übersteigt. Fußball ist freilich nicht mit den Schönen Künsten verwandt. Er ist ein rohes Geschehen und vollzieht sich im Augenblick, wie der Einschlag eines Meteoriten.
Und doch:
Im Drama des Fußballs findet man Elemente, die wir von anderen Dramen kennen, von den Dramen des Theaters, des Films, der Politik. Anders als in diesen entsteht seine Poesie aus einem gemeinen Spiel, das sich von der hohen Kultur abkehrt. Die Abwehr gegen den hohen Ton, den guten Geschmack, die vergeistigte Haltung lässt sich nicht mit Begriffen beschreiben, die der Hochkultur entnommen werden.
Quelle Gunter Gebauer a.a.O. Seite 8 und 9
Ein bisschen abweichend von dem, was Barenboim oben gesagt hat, kann der Dirigent dem Oboisten sehr wohl klarmachen, dass er eine Phrase anders gespielt haben will und auf welche Weise. Er kann erwarten, dass der Oboist ihn versteht und darauf eingeht; er kann in der Probe (!) darauf beharren, ihm zur Not vorsingen, wie es sein soll, und ihn, wenn er es in der Aufführung doch anders macht als verabredet, zur Rede stellen bis hin zur Abmahnung, falls er sich störrisch zeigt. Der Dirigent ist gerade in diesen Fragen nicht machtlos! Aber er kann den Part nicht selber spielen, das ist klar, und der Oboist erkennt natürlich auch, wenn der Chef Unmögliches verlangt und ihn vielleicht nur „vorführen“ (eine Schwäche offenlegen) will.
Im Fußball spricht man von Standard-Situationen, für die man Absprachen treffen kann. Und die Spieler haben das umzusetzen. Sie müssen die Rollen spielen, die er ihnen vorgeschrieben hat (sonst nimmt er sie aus dem Spiel). Aber es gibt keine Partitur, und er kann nur einen ungefähren Schlachtplan entwerfen, denn es gibt – anders als auf der Konzertbühne – nicht einfach noch andere Menschen mit unterschiedlichen Einfällen und Begabungen, sondern es gibt eine gegnerische Mannschaft (mit gegnerischem Trainer), die die Arbeit unserer Mannschaft (samt Trainer) zunichte machen will.
Fast alle Konflikte auf dem Konzertpodium jedoch sind werkimmanent. Wieviel Querelen auch zwischen den Menschen auf und hinter der Bühne bestehen oder zwischen denen im Publikum, während der Aufführung müssten sie alle ausgeschaltet sein. Zugunsten des einen Ziels einer guten Aufführung.
Das Ziel einer Fußballmannschaft aber ist nicht, ein gutes Spiel zu machen, sondern ein siegreiches. Und wenn sie dabei viel riskiert und die andere auch, wird es sehr spannend, aber nicht unbedingt ein mustergültiges, ästhetisch bewertbares Spiel.
***
Man spürt deutlich, dass es sich genauso verhält, wie Barenboim nahelegte, als er das Thema ohne weiteres blockierte: „Man soll es nicht vergleichen“! (Immerhin hat er dann den Fehler gemacht, den Dirigenten allzu streng vom Trainer abzusetzen, obwohl der Dirigent in der Zeit des Einstudierens vor dem Konzert eben doch auch ein Trainer ist.) Die Quelle der Fehler in solcher Diskussion liegt aber darin, dass man für die verschiedensten Tätigkeiten immer dasselbe Wort benutzen darf, nämlich SPIEL, ein Wort, das durch eine bestimmte philosophische Tradition eine unglaubliche Aufwertung erfahren hat. Zugleich eine unglaubliche Abwertung, wenn es – offen oder verborgen – dem Begriff der ARBEIT entgegengesetzt wird.
Beispiel aus dem Alltag: der Mann kommt vom Klavier und fragt, was hast du denn eigentlich getan? Und die Frau antwortet: Ich habe die ganze Zeit gearbeitet, während du dich deinem Hobby gewidmet hast. Du weißt, entgegnet er, es ist wissenschaftlich erwiesen, dass die Arbeit am Klavier einen enormen Umsatz geistiger Energie verlangt. Ja, sagt sie, dafür möchte ich auch Zeit haben. Er: Die nähmst du dir ganz sicher, wenn du in deiner Jugend nur ein bisschen Zeit ins Üben investiert hättest, statt in das endlose Geschwätz mit deinen Freundinnen. Sie: Dafür bin ich heute im Umgang mit andern Menschen geschickter als du. Das hast du oft genug selbst feststellen können. Soziale Kompetenz nennt man das. Etc. etc. ad infinitum.
(Ich schwöre: das Beispiel ist frei erfunden!)
Es lohnt sich, den Ursprung der Diskussion über das Spiel und das Spielen aufzusuchen. Letztlich bei Plato, aber vielleicht genügt es, dem berühmten Satz Friedrich Schillers nachzugehen, meist unvollständig zitiert: der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.
Schiller macht es sich im Originaltext durchaus nicht so einfach, wie es hier klingt, in Wahrheit ist es ein Doppelsatz, und dann vergisst er auch nicht hinzuzufügen, dass er uns eigentlich paradox erscheinen müsste:
Denn, um es endlich auf einmal herauszusagen, der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Worts Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Dieser Satz, der in diesem Augenblicke vielleicht paradox erscheint, wird eine große und tiefe Bedeutung erhalten, wenn wir erst dahin gekommen sein werden, ihn auf den doppelten Ernst der Pflicht und des Schicksals anzuwenden; er wird, ich verspreche es Ihnen, das ganze Gebäude der ästhetischen Kunst und der noch schwierigern Lebenskunst tragen.
In der Tat handelt es sich um einen gedanklichen Zusammenhang, den man kennen müsste, und um ein Hauptwerk von Schiller, das vielleicht wichtiger ist als Wilhelm Tell oder alle Balladen zusammengenommen.
Ich nehme mir Zeit dafür, es anhand der eingefügten Links zu rekapitulieren, spielerisch natürlich. Und erst danach Johan Huizinga neu zu bedenken, dessen Buch Homo Ludens uns Anfang der 60er Jahre aufgenötigt wurde, als sei es der Inbegriff einer neuen Musikpädagogik, – gleichzeitig mit dem täglich verschärften Übepensum und einem Sonderfach mit dem Namen „Methodik“.

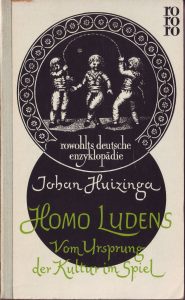 Zum „Homo Ludens„.
Zum „Homo Ludens„.
Es ist bemerkenswert, wie Huizinga in seinem frühen Buch (deutsch bei rde seit Juli 1956) mit dem Sport verfährt. Nach seiner Ansicht
geht mit der stets zunehmenden Systematisierung und Disziplinierung des Spiels auf die Dauer etwas von dem reinen Spielgehalt verloren. Dies offenbart sich in der Scheidung der Spieler in Professionelle und Liebhaber. Die Spielgruppe scheidet diejenigen aus, für die das Spiel kein Spiel mehr ist, und die, obwohl von hoher Kapazität, im Range unter den echten Spielern stehen. Die Haltung des Berufsspielers ist nicht mehr die richtige Spielhaltung; das Spontane und Sorglose gibt es nicht mehr bei ihm. Nach und nach entfernt sich in der modernen Gesellschaft der Sport immer mehr aus der reinen Spielsphäre und wird ein Element sui generis; nicht mehr Spiel und doch auch kein Ernst. Im heutigen Gesellschaftsleben nimmt der Sport einen Platz neben dem eigentlichen Kulturprozeß ein, und dieser findet außerhalb von ihm statt. (…)
Diese Auffassung widerstreitet geradewegs der geläufigen öffentlichen Meinung, für die der Sport als das im höchsten Grade bezeichnende Spielelement in unserer Kultur gilt. Das ist der Sport keineswegs, hat er doch im Gegenteil das Beste seines Spielgehalts verloren. Das Spiel ist allzu ernst geworden, die Spielstimmung ist mehr oder weniger aus ihm gewichen. Es verdient beachtet zu werden, daß die Verschiebung nach dem Ernst zu auch die nicht athletischen Spiele betroffen hat, besonders die Spiele, bei denen verstandesmäßige Berechnung alles ist, wie beim Schach oder beim Kartenspiel.
Quelle Johan Huizinga: Homo Ludens Vom Ursprung der Kultur im Spiel / rowohlts deutsche enzyklopädie rde Rowohlt Taschenbuch Verlag Reinbek bei Hamburg 1956 (März 1961) Seite 187 f
Heute Abend, 11. April 2017, ist – während ich dies schreibe – vielleicht zu einem fatalen Datum für den Fußball oder den Sport überhaupt geworden: durch den dreifachen Sprengstoff-Anschlag auf den Bus der BVB-Mannschaft bei der Anfahrt zum Dortmunder Stadion, wo das Spiel Dortmund gegen Monaco stattfinden sollte. Dem Vernehmen nach ist es auf morgen verlegt, aber wie kann ein sogenanntes Spiel überhaupt noch durchgeführt werden, wenn die kleinste Wahrscheinlichkeit besteht, dass sowohl die Spieler wie eine riesige Zuschauermenge um Leib und Leben fürchten müssen?
***
Themenwechsel 14.04.2017
ZITAT
Richard David Precht über John Dewey, ästhetische Erfahrungen und Fußball (HIER) ab 15:32
Dieses Werk „Art as Experience“ (1934) versucht herauszufinden, wann und wo machen wir ästhetische Erfahrungen? Und eins der wichtigsten Dinge ist, dass die alte Kategorisierung – Was würde Kant sagen: wo machen wir ästhetische Erfahrungen? im Naturschönen und im Kunstschönen. Und Dewey stellt sich die Frage: Stimmt das? machen wir nicht pausenlos ästhetische Erfahrungen. Ich bin der Überzeugung, dass der größte Teil von Ihnen, der gestern Abend Fußball geguckt hat, dabei eine große ästhetische Erfahrung gemacht hat. Selbst eine Robben-Schwalbe ist in gewisser Hinsicht ein ästhetisches Ereignis, ja, und ich meine das ganz im Ernst. Und auch die Gefühle, die Sie dabei gehabt haben, ja, also diese vielleicht parareligiösen Gefühle, die Sie empfunden haben, anhand von einem unüberschaubaren Ornament , ja, aus etwas … ich meine, Fußball ist insofern schon wahnsinnig ästhetisch, als dass es wie die moderne Kunst den ganzen Reiz aus dem Nicht-Gelingen zieht. Fußball ist eine Artistik des Misslingens, Sie versuchen tausendmal ein Tor zu schaffen und schaffen es am Ende ein Mal in der Verlängerung, nicht, also eine wunderbare Parabel für das, was ein zentrales Thema der Avantgarde ist, Adorno – das ist ein Gelingen, in der modernen Kunstwelt eigentlich im Sinne von Harmonie und Vollendung, also was wir schon von den alten Griechen kannten, gar nicht geben kann, und Dewey sagt: wir können ästhetische Erfahrungen machen, indem wir eine riesige Maschine, einen riesigen Kran sehen, der irgendetwas schleppt, ein Seil zieht oder dergleichen, also: ästhetische Erfahrungen an Dingen machen, die [nicht] kein Naturschönes sind, die aber auch nie zum Zweck, Kunstschönes zu sein, in irgendeiner Form je etabliert worden sind. Was gar nicht der Sinn der Übung ist. Aber wir machen trotzdem an ihnen ästhetische Erfahrungen. Genauso wie Dewey überhaupt kein Problem damit hätte, ein Weltmeisterschaftsspiel, oder ein Fußballspiel überhaupt als eine ästhetische Erfahrung zu begreifen. Adorno hätte damit ein Problem. Für Adorno war das, was Sie da massenhaft gesehen haben, ein Verblendungszusammenhang innerhalb einer degenerierten Kulturindustrie. (Lachen) Brot und Spiele und so weiter, furchtbar! Und die Tatsache, dass Sie sich mit 11 Leuten identifizieren und sich dann anschließend als Weltmeister fühlen usw. wäre so unterirdisch, dass man sich damit gar nicht beschäftigen müsste. Dewey würde in dieser Form gar nicht werten, sondern er würde von Anfang an sagen: es ist eine ästhetische Erfahrung, Feierabend! Und ästhetische Erfahrung muss nicht eingehegt werden. Wir müssen also keine Reservate für ästhetische Erfahrungen schaffen. In Form von Landschaften, oder in Form eben von sogenannten Kunstwerken, denen wir das Etikett Kunstwerk ankleben. Damit weicht der Kunstwerkbegriff auf, und dieses Aufweichen des Kunstwerkbegriffs war eben enorm einflussreich im Hinblick auf die ästhetische Entwicklung der amerikanischen Avantgarde und damit der Avantgardekunst überhaupt. Also bis hin zur Konzeptkunst und Fluxusbewegung und alles was dazugehört, Happenings, ja, ein Happening, das ist im Grunde genommen eine Weiterentwicklung von dem, was Dewey sagt. Es ist ja das Gegenteil von Einhegen in Kunst. Es war dann auch Kritik an dem Werk, ja, was soll denn überhaupt ein Werk sein? Der große Kran, der da so majestätisch über den Hafen auslädt, ist kein Werk. Aber ich mache an ihm eine ästhetische Erfahrung.(18:47)
Quelle Richard David Precht – Vorlesung Ästhetik – Leuphana Universität Lüneburg. Vorlesungen seit dem Wintersemester 11/12. Veröffentlicht am 28.07.2014. (Niederschrift JR 14.04.2017).
Den folgenden Text fand ich heute (16.04.2017) bei ZEIT online HIER, nachdem ich bei Martin Seel in dem Buch „Die Macht des Erscheinens“ (Suhrkamp 2007) einen Abschnitt gelesen hatte, in dem er über einen Aufsatz von H. U. Gumbrecht berichtet: „Die Schönheit des Mannschaftssports“ in G.Vattimo / W.Welsch (Hg.), Medien – Welten – Wirklichkeiten 1998 (Seite 201-228).
Der Zuschauer im modernen Sport, das ist Gumbrechts positive These, nimmt an einer Produktion unwahrscheinlicher Ereignisse teil. Im Fall des American Football geschieht dies durch das sekundenschnelle Erzeugen und Zerstören von Spielzügen, mit denen die angreifende Mannschaft Raum zu gewinnen, die gegnerische dagegen ihren Raum zu verteidigen versucht. So kommt es zu der plötzlichen Entstehung einmaliger Formen aus körperlichen Bewegungen, die im nächsten Augenblick auf der Leere des Spielfeldes wieder ausgelöscht sind. Das ausgefeilte Kalkül der wechselseitigen Spielstrategien bringt unkalkulierbare Handlungsfolgen hervor. In den geordneten Bahnen eines geregelten Wettkampfs erleben die Zuschauer eine permanente Vereitelung von Ordnung. Sie werden nicht eines höheren Sinnes teilhaftig, sie berauschen sich an Mysterien der Kontingenz.
Die existentielle und kulturelle Bedeutung dieses Rituals freilich wird so noch nicht deutlich. Was sich in den Stadien und an den Bildschirmen ereignet, sagt Gumbrecht, ist eine „Produktion von Präsenz“. Eingeschüchtert durch die philosophische Kritik an der sogenannten „Präsenzmetaphysik“, will er diese Gegenwart jedoch vorwiegend als ein räumliches Verhältnis verstanden wissen. Im Rhythmus von Aktion und Gegenaktion, Anspannung und Lethargie seien die Zuschauer dem Geschehen des Spiels besonders nahe, weil sie nicht zur Imagination von etwas anderem entführt würden. Mit räumlicher Nähe aber hat diese Involviertheit nichts zu tun. Das entscheidende Merkmal ist vielmehr ein zeitliches. Weil die sportliche Performance keinen über sich selbst hinausweisenden Sinn vermittelt, lenkt nichts von der Zeit ihrer Darbietung ab. Das erlaubt es den Zuschauern, eine kollektive Auszeit von den Kontinuitäten ihres Lebens zu nehmen – eine Auszeit, die sie nicht, wie diejenige der Kunst, über das Spiel ihres Lebens zu reflektieren zwingt. Trotzdem kriegen die Leute etwas für ihr Geld: die Gelegenheit zu einer – je nach Ergebnis – jubelnden oder verzweifelten Affirmation der Zufälligkeit ihres Lebens.
In jeder vernünftigen Stadt finden sich deshalb zahlreiche Hinweisschilder zum Ausgang aus dem Gehäuse des garantierten Sinns – jenem Ausgang, den der Held in Peter Weirs Film The Truman Show so mühsam suchen muß. Er liegt am Eingang zu den Stadien. Auch die überdachten unter ihnen sind für eine Feier der prinzipiellen Obdachlosigkeit des menschlichen Daseins da.
Quelle DIE ZEIT, 14/1999 Mysterien der Kontingenz Von Martin Seel (31. März 1999)
Und zum Schluss kann ich nun (Dank an JMR!) doch noch einen Text von Gumbrecht vermitteln, der nicht umsonst von Freunden mit dem berühmten Vornamen Sepp angeredet wird, einen Text, der sich direkt auf Fußball bezieht. DIE ZEIT 21. März 2016 Die Zuhandenheit im Sport – „Im Fußball gibt es immer neue Lösungen, aber keine definitiven Wahrheiten – ein sporthistorisches Essay“. Von Hans-Ulrich Gumbrecht. HIER.
ZITAT
Im Team verwirklicht sich eine flexible Modalität erfolgsorientierter Sozialbeziehungen, für die wir keinen alltagssprachlichen Begriff haben, sondern eben nur die Anschauung des Sports. (…)
Wie schwer es uns fällt, auf die Rede vom Team zu verzichten, verstärkt darüber hinaus die Intuition, dass die sich immer verändernden, von genialen Spielern verkörperten Choreografien längst schon einen prägenden und inspirierenden Einfluss auf die soziale Wirklichkeit genommen haben. Diese Denkmöglichkeit macht die intellektuelle Herausforderung des Fußballs – und des Sports überhaupt – in unserer Gegenwart aus, weil erst sie das Vorzeichen von der schönsten Nebensache hinter sich lässt. Sie muss nicht unbedingt zu dem Versuch führen, den Sport entschlossener als eine Quelle von Variationen in unserem Weltverhältnis zu nutzen – weil ja gerade in der Distanz zum Alltag der praktischen Ziele und Funktionen eine[r] seiner Stärken liegt.
(Gumbrecht a.a.O.)
* * *
ZITAT Solinger Tageblatt 22. Juni 2018 Seite 9
Und diese Ziele muss Joachim Löw benennen.
Lobinger: Das ist wie bei einem Orchester. Der Trainer ist der Dirigent, der alles bis zum kleinsten Prozess aufteilt und danach sagt: Wir wissen, was von uns erwartet wird und sind gewappnet, dieser Aufgabe zu begegenen. Und wenn jedes Rädchen ins andere greift, geht unser Plan auf. Und wenn der nicht aufgeht, dann haben wir noch einen zweiten Plan.
Quelle Solinger Tageblatt (s.o.): Ist dem Team der Druck zu groß? Interview Die Kölner Sportpsychologin Babett Lobinger über die Gefühlslage der deutschen Elf. Und Ronaldo als Vorbild. (Interview: Susanne Fetter)