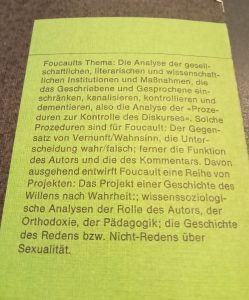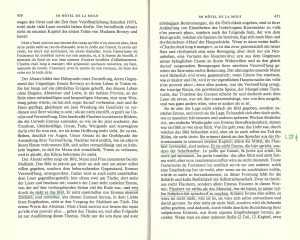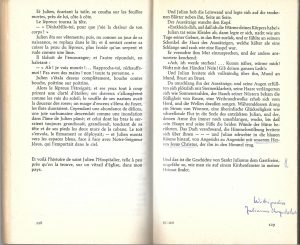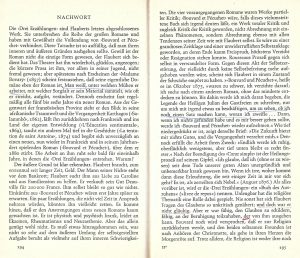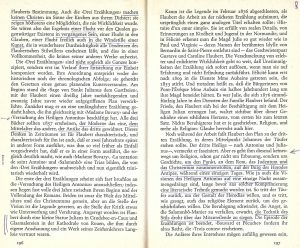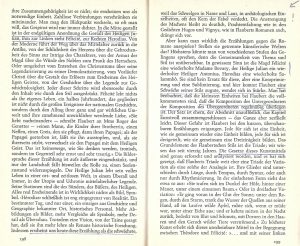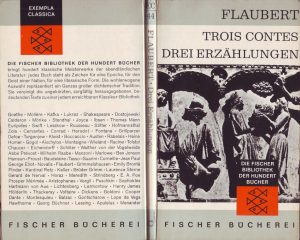Keine Notsituation, aber höchste Zeit (zum Lesen)
 Aussicht aus dem Klinikum. Viel heller liegt das schmale grüne Buch vor mir, und etwas über 40 Jahre entfernt. Damals las ich: „Überwachen und Strafen“ sowie „Sexualität und Wahrheit 1“ von Michel Foucault. JMR wusste das, er war erst 16. Und dieses, warum las ichs nicht? Kaum, – vielleicht zu theoretisch für mich. Heute werde ich es bis zum Ende mit gleicher Aufmerksamkeit lesen (dank Erinnerung an Kant). Ich werde die Sätze abschreiben, die ich richtig gut fand, die auf dem rückseitigen Cover nicht). Das zweite Werk „Schriften zur Literatur“ ist heute nur Beifang – an derselben Stelle im Regal, wo das andere sich versteckt hatte, sträflich missachtet, unglaublicher Fehler, gerade wo es mir seit damals hätte helfen können, Flaubert näherzukommen! Siehe unten den Link zum Artikel „Die ernste Geschichte der Figura“….
Aussicht aus dem Klinikum. Viel heller liegt das schmale grüne Buch vor mir, und etwas über 40 Jahre entfernt. Damals las ich: „Überwachen und Strafen“ sowie „Sexualität und Wahrheit 1“ von Michel Foucault. JMR wusste das, er war erst 16. Und dieses, warum las ichs nicht? Kaum, – vielleicht zu theoretisch für mich. Heute werde ich es bis zum Ende mit gleicher Aufmerksamkeit lesen (dank Erinnerung an Kant). Ich werde die Sätze abschreiben, die ich richtig gut fand, die auf dem rückseitigen Cover nicht). Das zweite Werk „Schriften zur Literatur“ ist heute nur Beifang – an derselben Stelle im Regal, wo das andere sich versteckt hatte, sträflich missachtet, unglaublicher Fehler, gerade wo es mir seit damals hätte helfen können, Flaubert näherzukommen! Siehe unten den Link zum Artikel „Die ernste Geschichte der Figura“….
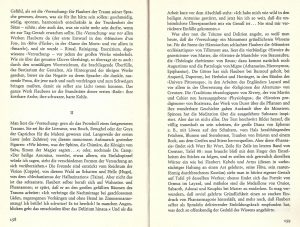 Wie Flaubert arbeitete …. / aus dem letzen Kapitel des Buches Schriften zur Literatur von Michel Foucault: Un »fantastique de bibliothèque« / Nachwort zu Gustave Flauberts Die Versuchung des heiligen Antonius / Schriften zur Literatur / Übersetzung: Karin von Hofer / Ullstein Materialien 1979 ISBN 3-548-35011-9
Wie Flaubert arbeitete …. / aus dem letzen Kapitel des Buches Schriften zur Literatur von Michel Foucault: Un »fantastique de bibliothèque« / Nachwort zu Gustave Flauberts Die Versuchung des heiligen Antonius / Schriften zur Literatur / Übersetzung: Karin von Hofer / Ullstein Materialien 1979 ISBN 3-548-35011-9
Michel Foucault: Die Ordnung des Diskurses
Zitate
S.32 Es könnte sein, daß der Gedanke des begründenden Subjekts es erlaubt, die Realität des Diskurses zu übergehen. Das begründende Subjekt hat ja die Aufgabe, die leeren Formen der Sprache mit seinen Absichten unmittelbat zu beleben; indem es die träge Masse der leeren Dinge durchdringt, ergreift es in der Anschauung den Sinn, der darin verwahrt ist; es begründet auch über die Zeit hinweg Bedeutungshorizonte, welche die Geschichte dann nur noch mehr entfalten muß und in denen die Sätze, die Wissenschaften, die Deduktionen ihr Fundament finden. In seinem Bezug zum Sinn verfügt das begründende Subjekt über Zeichen, Male, Spuren, Buchstaben. Aber es muß zu seiner Offenbarung nicht den Weg über die besondere Instanz des Diskurses nehmen.
Diesem Thema steht der Gedanke der ursprünglichen Erfahrung gegenüber, der ein analoge Rolle spielt. Er setzt voraus, daß in der rohen Erfahrung, noch vor ihrer Fassung in einem cogito, vorgängige, gewissermaßen schon gesagte Bedeutungen die Welt durchdrungen haben, sie um uns herum angeordnet und von vornherein einem ursprünglichen Wiedererkennen geöffnet haben. Eine erste Komplizenschaft mit der Welt begründet uns so die Möglichkeit, von ihr und in ihr zu sprechen, sie zu bezeichnen und zu benennen, sie zu beurteilen und schließlich in der Form der Wahrheit zu erkennen. Was kann der Diskurs dann legitimerweise anderes sein als ein behutsames Lesen? Die Dinge murmeln bereits einen Sinn, den unsere Sprache nur noch zu heben braucht; und diese Sprache sprach uns ja immer schon von einem Sein, dessen Gerüst sie gleichsam ist.
S.35 Es herrscht zweifellos in unserer Gesellschaft – und wahrscheinlich auch in allen anderen, wenn auch dort anders profiliert und skandiert – eine tiefe Logophobie, eine stumme Angst vor jenen Ereignissen, vor jener Masse von gesagten Dingen, vor dem Auftauchen all jener Aussagen, vor allem, was es da Gewalttätiges, Plötzliches, Kämpferisches, Ordnungsloses und Gefährliches gibt, vor jenem großen unaufhörlichen und ordnungslosen Rauschen des Diskurses.
Vgl. im Blog: Kant-Artikel über das „Gewühl“ hier.
S.36 Ein Prinzip der Spezifizität. Der Diskurs ist nicht in ein Spiel von vorgängigen Bedeutungen aufzulösen. Wir müssen uns nicht einbilden, daß uns die Welt ein lesbares Gesicht zuwendet, welches wir nur zu entziffern haben. Die Welt ist kein Komplitze unserer Erkenntnis. Es gibt keine prädiskursive Vorsehung, welcher uns die Welt geneigt macht. Man muß den Diskurs als eine Gewalt begreifen, die wir den Dingen antun; jedenfalls als eine Praxis, die wir ihnen aufzwingen. In dieser Praxis finden die Ereignisse des Diskurses das Prinzip ihrer Regelhaftigkeit.
S.37 (…) zwei Bemerkungen (…) Geschichtsschreibung. Man behauptet häufig von der heutigen Historie, daß sie die einstigen Privilegien des einzelnen Ereignisses aufgehoben und die Strukturen der langen Dauer zur Erscheinung gebracht habe. Gewiß. Doch ich bin nicht sicher, daß die Arbeit der Historiker genau in diese Richtung geht. Oder vielmehr, ich glaube nicht, daß zwischen dem Ausfindigmachen des Ereignisses und der Analyse der langen Dauer ein Gegensatz besteht. Gerade indem man sich sich auch den geringsten Ereignissen zugewendet hat, indem man die Erhellungskraft der historischen Analyse bis in die Marktberichte hinein, in die notariellen Urkunden, in die Pfarrregister, in die Hafenarchive vorangetrieben hat, die Jahr für Jahr, Woche für Woche verfolgt werden, hat man jenseits der Schlachten, der Dekrete, der Dynastien oder der Versammlungen massive Phänomene von jahrhundertelanger Tragweite in den Blick bekommen.
Die letzten 5 Seiten des Diskurses gehören Hegel und – Jean Hyppolyte .
S.50 Nicht nur ich schulde Jean Hyppolyte Dank: denn er hat für uns und vor uns den Weg durchlaufen, auf dem man sich von Hegel entfernt und Distanz nimmt, auf dem man aber auch wieder zu ihm zurückgeführt wird, aber anders und so, daß man ihn von neuem verlassen muß.
Zunächst hatte sich Jean Hyppolyte bemüht, dem großen und etwas gespenstischen Schatten Hegels, der seit dem 19. Jahrhundert herumgeisterte und mit dem man sich im Dunkeln herumschlug, eine Gegenwart zu geben. Er tat dies durch eine Übersetzung der Phänomenologie des Geistes. Daß Hegel in diesem französischen Text gegenwärtig ist, beweisen jene Deutschen, die ihn gelegentlich konsultiert haben, um seine »deutsche Version« besser zu verstehen.
Quelle Michel Foucault: Die Ordnung des Diskurses / Inauguralvorlesung am Collège de France – 2.Dezember 1970 / Anthropologie – Herausgegeben von Wolf Lepenies und Henning Ritter / übersetzt von Walter Seitter / Carl Hanser Verlag München 1974 / Ullstein Buch Nr. 3367 Verlag Ullstein Frankfurt/M. – Berlin – Wien 1977