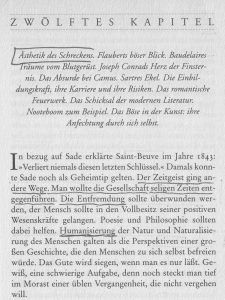Große Begriffe rekapitulieren?
Es ist vielleicht typisch für dieses Lebensalter, immer wieder zu rekurrieren auf die frühen 60er Jahre (als ich die Franzosen entdeckte – „clarté“ – und den frühen Hang zum magischen Denken durch den Begriff „Entzauberung“ bannte), angefangen mit Musils tagheller Mystik bis hin zu Sartres „Die Wörter“. Aber es ist nicht nur mein Problem: alle machen mit. Die Frankfurter Buchmesse mit Thema Frankreich, die neuen Impulse (dank Macron?), auf hohem Niveau das Sonderheft ZEIT-Literatur Oktober 2017 („Frankreich schreibt wieder“) bis hinunter zu einer unsäglich schwachen Ausgabe des „Literarischen Quartetts“ (Ausnahme: die immer hellwache Thea Dorn); ein dort besprochenes Buch verliert jeden Appeal (ZDF 13. Oktober 2017). So auch Kehlmanns „Tyll“. Anders bei Jens Jessen (im ZEIT-Heft), wo man wirklich etwas über die Erzählweise erfährt, auch über interessante Gestalten, unter ihnen „der legendäre (und hier unvergleichlich scheußliche) Universalgelehrte Athanasius Kircher“, Grimmelshausen, Gryphius und Fleming, dann vor allem Alfred Döblin mit seinem vergessenen Wallenstein, dem „Nachahmungseifer“ bei Günter Grass und Wolfgang Koeppen, überhaupt dem Dreißigjährigen Krieg (mir unvergessen bleibt die Behandlung in – „Bachs Welt“ von Volker Hagedorn). Damals, Anfang der 60er, las ich Flauberts „Drei Erzählungen“ (Trois Contes), blieb völlig ratlos, jetzt liegen sie wieder auf dem Nachttisch, dank Andreas Isenschmid (aber nicht in der von ihm besprochenen neuen Übersetzung): Revolte gegen sich selbst / Wie der Meister des unempfindlichen Erzählens „empfindsame Seelen zum Weinen bringen“ wollte. Flauberts letzte Geschichten in einer Neuübersetzung von Elisabeth Edel bei Hanser München, mit „einem fabelhaften Nachwort“ und in einer Briefauswahl auch „einen genauen Blick in Flauberts ästhetischen Kampf mit sich selber“ bietend.

 … und doch unverstanden bis heute?
… und doch unverstanden bis heute?
Ich will gar nicht die Gründe darlegen. Es war der Stoff, der mich abstieß, nicht die Sprache, die ich liebte, ohne sie beurteilen zu können. Heute nur wenig mehr.
Was mich an dem Artikel über den Philosophen Tristan Garcia jedoch fasziniert, ist das gleiche, was mich nachträglich skeptisch macht: die scheinbar einfache Lösung, die schon im Titel seines aktuellen Werkes liegt: „Das intensive Leben“. Ijoma Mangold:
Gegen die rationalistische Berechenbarkeit und Entzauberung der Welt war die Intensität ein Antidot, um 1800 herum besonders gern von der aristokratischen décadence gepflegt – die Intensitätswonnen der Grausamkeiten hatte der Marquis de Sade auf den Begriff gebracht.
Natürlich stutzt man: heute gibt es ernstzunehmende Buchtitel wie „Die Kunst und das gute Leben“ (Rauterberg über die Ethik der Ästhetik). Damals las man Adornos Deutung zu Samuel Becketts „Endspiel“. Wie ist das zusammenzubringen? In Safranskis großer Abhandlung über „Das Böse“ gibt es ein tolles Kapitel über die Ästhetik des Schreckens.
Zu fragen wäre: geht es um eine Ästhetik oder um das Leben? Phantasie oder Wirklichkeit? Oder – wenn die Phantasie zu schwache Wirkung zeitigt – um einen Übergang ins Leben? Gestern Abend der Fernsehbericht über einen italienischen Kriegsfotografen, der – mit merkwürdigen Argumenten – in Tschetschenien dem Krieg und damit dem wirklichen Leben (?) näher sein wollte. (Er ist jetzt tot.) Es erinnert mich an die Wende bei Rimbaud, den Badiou in seinem Buch an die Jugend als Muster nimmt. Es sind diese Dichotomien, die mich misstrauisch stimmen. Und wenn einer vom intensiven Leben spricht, frage ich in diesem Sinne: meint er Phantasie oder Wirklichkeit. Oder versucht er die Grenzen durch eine unscharfe Kameraeinstellung zu verwischen? Um es krass zusagen: hat de Sade im Sessel gelehnt und imaginiert oder hat er real Menschen gequält? (Wenn es nach dem Prinzip der Bergpredigt geht, gilt beides für gleich.) In Mangolds Essay über Tristan Garcia erscheinen die „Intensitätswonnen der Grausamkeit“ (s.o.), die „der Marquis des Sade auf den Begriff gebracht“ habe, – auf den Begriff?! – nach der Kurzdarstellung eines Gedankengangs, den man glaubt, aus Fritjof Capras Zeiten zu kennen:
Während man auf den ersten Blick meinen könnte, Das intensive Leben sei eine Verteidigung der Intensität gegen die konsumkapitalistisch sedierte Lauheit der Gegenwart, ist die Gedankenfigur, die Garcia darin entwickelt, doch deutlich denkintensiver: Dieses ausgesprochen originelle Buch erzählt auf philosophische Weise eine historische Entwicklungsgeschichte. Als Wert nämlich trat die Intensität in jenem Moment in Erscheinung, als mit Newton und Descartes die Welt vollständig physikalisch erklärt werden sollte – und zwar durch ein räumlich-quantitatives Denken. Für spezifische Qualitäten (die qualia* der antiken Philosophie) gab es in der neuzeitlichen Kosmologie keinen Platz mehr, es gab nur noch Raum und Ausdehnung, alles wurde geometrisiert und zählbar.
Während Newtons Physik alles, was messbar ist, erklären konnte, schloss sie aber das, was nicht zählbar, sondern nur fühlbar ist, aus dem Sein aus. Ihr Prüfstein für Wirklichkeit war das naturwissenschaftliche Experiment, dessen erste Bedingung Wiederholbarkeit lautet. Das Einzigartige, das Unwiederholbare erschient nicht auf dem Bildschirm. Und hier kommt die Intensität als Gegensehnsucht ins Spiel. Garcia schreibt: „Angesichts der nahezu vollständigen Extensionalisierung der Welt hat das vage Gefühl, dass diese Welt unlebbar geworden war oder dass sie, genauer gesagt, keinen ausreichend stimulierenden Grund bot, um gelebt, bewohnt oder erfahren zu werden, den modernen Rationalismus heimgesucht, der außerstande war, der Einbildungskraft ein mitreißendes und erregendes Bild der Realität zu bieten.“
Quelle ZEIT LITERATUR Oktober 2017 (Seite 23 f) Klar denken! Tristan Garcia ist Schriftsteller und Philosoph und in beiden Rollen jemand, der unsere Gegenwart auf den Begriff bringt. Wir haben ihn in Lyon getroffen und viel darüber gelernt, wie durch kluge Unterscheidungen das Emanzipationsversprechen der Moderne gerettet werden kann / Von Ijoma Mangold.
* zu den qualia: ist das wirklich richtig, was Mangold da schreibt? „die qualia der antiken Philosophie“ – in Wahrheit wohl erst ein Problem der neuzeitlichen Philosophie. Siehe auch bei Wikipedia hier.
Ich darf mich auch selbst bezichtigen: ich weiß, dass ich dergleichen Anfang der 60er Jahre in Briefen beschrieben habe, als sei es ein eigener Gedanke, weiß aber auch, dass ich nicht wusste, dass ich es in der Colerus-Biographie über Leibniz gelesen haben musste. Heute weiß ich es (immerhin ein Fortschritt in 55 Jahren) dank Wikipedia (habe allerdings inzwischen auch Ivan Nagels „Fledermaus“-Schrift gelesen, besitze auch seit 1990 Martin Kurthens „Neurosemantik“ sowie Thomas Metzingers Wälzer „Bewußtsein“ und weiß doch schon etwas mehr über die Bedeutung der Qualia):
Leibniz lässt uns durch ein gigantisches Modell des Gehirns laufen. Ein solches Modell wird darüber informieren, wie im Gehirn Reize auf eine sehr komplexe Art und Weise verarbeitet werden und schließlich mittels Erregungsweiterleitung in verschiedenen Körperteilen zu einer Reaktion führen. Aber, so Leibniz, nirgendwo werden wir in diesem Modell das Bewusstsein entdecken. Eine neurowissenschaftliche Beschreibung werde uns also über das Bewusstsein vollkommen im Dunkeln lassen. In Leibniz’ Gedankenexperiment kann man leicht das Qualiaproblem entdecken. Denn zu dem, was man in dem Gehirnmodell nicht entdecken kann, gehören ganz offensichtlich auch die Qualia. Das Modell mag uns etwa darüber aufklären, wie eine Lichtwelle auf die Netzhaut trifft, dadurch Signale ins Gehirn geleitet und dort schließlich verarbeitet werden. Es wird uns nach Leibniz’ Ansicht jedoch nicht darüber aufklären, warum die Person eine Rotwahrnehmung hat. (Wikipedia)
(Fortsetzung folgt)