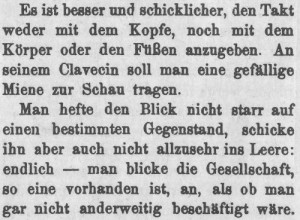Das Editorial der Zeitschrift Arch+
Die Geschichte gegen den Strich bürsten
von Ngo, Anh-Linh
[Abdruck im Blog JR mit freundlicher Erlaubnis des Verlags]
Wer einmal auf dem windumtosten Vorplatz des Gemeindefriedhofs von Portbou an der französisch-spanischen Grenze gestanden hat, um das Denkmal für Walter Benjamin zu besuchen, den verlässt das Bild und das Gefühl der Ausweglosigkeit nicht mehr. Ein scharfkantiger dreieckiger Stahlkörper ragt vor dem Hintergrund der weißgetünchten Friedhofsmauer dunkel in den Himmel. Er markiert den Eingang in die „Passagen“, einen engen, in den Felsen eingeschnittenen Schacht, der über 70 Stufen steil hinab zum Wasser führt. Man läuft in einem Tunnel dem Licht entgegen, der sich im letzten Drittel zum freien Himmel und hinab auf das unendliche Blau des Mittelmeeres öffnet. Der hypnotisierende Blick in die Tiefe betört, nur eine Glasscheibe verhindert den Abstieg über die letzten Stufen, die gefährlich über die Felsküste hinausragen. Die Weite des Meeres und des Himmels steht hier jedoch nicht für ein noch einzulösendes Freiheitsversprechen, sondern für die Unrettbarkeit und Einsamkeit des Individuums angesichts einer in Barbarei versinkenden Welt. Die begehbare Skulptur des israelischen Künstlers Dani Karavan schafft ein würdiges Gedenken an einen der größten Kulturtheoretiker des 20. Jahrhunderts, der 1940 in diesem gottverlassenen Grenzort auf der Flucht vor den Nazis keinen Ausweg mehr sah und sich das Leben nahm. Seinen Leichnam hat man mehrmals umgebettet und später in einem anonymen Massengrab beigesetzt. Das Denkmal, das wegen populistischer Kampagnen einiger deutscher Boulevardmedien wie der Bild-Zeitung beinahe gescheitert wäre, wurde erst 1994 fertiggestellt.
Szenenwechsel. Genau zehn Jahre zuvor, 1984, gewann Hans Kollhoff den Wettbewerb für die Neubebauung und Gestaltung des neu angelegten Walter-Benjamin-Platzes in Berlin-Charlottenburg. Aufgrund von Anwohnerprotesten und rechtlichen Streitigkeiten zwischen Bezirk und Senat verzögerte sich die Finalisierung des Baus bis ins Jahr 2000. Über die architekturhistorischen Bezüge des Entwurfs, die Verena Hartbaum in ihrem Essay in dieser Ausgabe auf eine gewisse Wahlverwandtschaft mit Marcello Piacentini – Mussolinis „Hofarchitekten“ – zurückführt, mag man streiten. Unstrittig ist jedoch, dass hier eine Wende stattgefunden hat, die den berüchtigten Versuch Léon Kriers vorwegnimmt, Albert Speer mit seinem 1985 herausgegebenen, monografischen Prachtband als Architekten zu rehabilitieren, den er gar für einen der größten des 20. Jahrhunderts hält. Der ideologische Abgrund, der sich hier öffnet, lässt sich an Details ablesen, die in ihrer schreienden Subtilität entweder auf Gedankenlosigkeit oder Niedertracht zurückgeführt werden müssen. Zum einen ist da das in den Boden des Platzes eingravierte Zitat des faschistischen Autors Ezra Pound, das zunächst nicht anstößig klingt, wenn da nicht der Antisemitismus des als Antisemiten bekannten Pound deutlich zutage träte: „Bei Usura hat keiner ein Haus von gutem Werkstein. Die Quadern wohlbehauen, fugenrecht, dass die Stirnfläche sich zum Muster gliedert.“ Man muss kein literaturwissenschaftliches Studium absolviert haben, um auf die Spur Pounds zu kommen, der für seine antisemitische Propaganda berüchtigt war und mit dem Codewort „Usura“, Italienisch für Wucher, „die Juden“ für die Herrschaft des bestehenden Zinssystems verantwortlich machte.
Was treibt einen Architekten dazu, bei der Gestaltung eines Platzes mitten in Berlin eine solche Konnotation anklingen zu lassen und buchstäblich in Stein zu meißeln? Dass dieser Platz im Laufe des Planungsprozesses auch noch einem jüdischen Intellektuellen gewidmet wird, welcher auf der Flucht vor den Nazis in einer ausweglosen Situation Selbstmord beging, macht das Zitat noch perfider – Kollhoff findet diese nachträgliche Gegenüberstellung sogar spannend, wie Hartbaum berichtet. Ein weiteres Detail macht stutzig: Auf dem Boden der Leibnizkolonnaden, die den Platz umgeben, ist ein Fliesenmuster verlegt, das in seiner Farbgebung in Richtung schwarz-rot-gold changiert, worauf Markus Miessen mit einer diese Ausgabe ankündigenden Plakataktion hinweist. Mit der bewussten Einschreibung des Pound-Zitats und der gestalterisch nationalkonservativen Aufladung des Platzes scheint der Architekt das Schicksal Benjamins geradezu verhöhnen zu wollen. Zwischen dem Beschluss der Bezirksverordnetenversammlung Anfang 2000, den Platz nach langen Debatten nach Walter Benjamin zu benennen und der Eröffnung der Anlage im Mai 2001 hätte man Gelegenheit gehabt, darauf zu reagieren. Es hätten sich in dessen an Aphorismen reichem Werk sicherlich genügend Zitate finden lassen, die ihm in seiner Heimatstadt das letzte Wort hätte geben können. Vielleicht auch diesen Satz, den er kurz vor seinem Tod in den „Geschichtsphilosophischen Thesen“ prophetisch niederschrieb: „[A]uch die Toten werden vor dem Feind, wenn er siegt, nicht sicher sein. Und dieser Feind hat zu siegen nicht aufgehört.“01 In der Tat erhebt dieser Feind heute in ganz Europa wieder sein Haupt und will in einem Akt der historischen Einfühlung die Geschichte neu schreiben und revidieren. Nicht anders ist der grassierende rekonstruktivistische Taumel zu erklären, der die sogenannte Mitte der Gesellschaft erreicht hat. Benjamin liefert in seinen Thesen einen möglichen Erklärungsansatz für diese Entwicklung:
„Fustel de Coulanges empfiehlt dem Historiker, wolle er eine Epoche nacherleben, so solle er alles, was er vom spätern Verlauf der Geschichte wisse, sich aus dem Kopf schlagen. Besser ist das Verfahren nicht zu kennzeichnen, mit dem der historische Materialismus gebrochen hat. Es ist ein Verfahren der Einfühlung.“02
Besser kann man das historisierende Verfahren, dessen sich die Rekonstruktivist*innen aller Couleur bedienen, nicht charakterisieren. Ob in Berlin, Dresden oder Frankfurt, ob in Ungarn, Polen oder in der Türkei, in allen Fällen steht das, wovon sich Benjamin mit Verweis auf den Historiker de Coulanges distanzieren will, im Mittelpunkt: Es geht bei diesem Verfahren der Einfühlung darum, den Verlauf der Geschichte vergessen zu machen. Daher der bewusste Bezug zu einer vermeintlich heileren Zeit. Daher die Anrufung von Bildern, die alles, was danach folgte, aus dem Gedächtnis tilgen sollen. Es geht hier, trotz aller Beteuerungen, nie um das echte historische Bild, das Benjamin zufolge nur flüchtig aufblitzen könne. Vielmehr will man Schluss machen mit dem angeblichen „Schuldkult“, den Rechte wie Björn Höcke beklagen. Das Motiv wird noch klarer, wenn man mit Benjamin fragt: Worin fühlen sich all jene heute eigentlich ein, die eine Art Geschichtsrevision mittels einer historisierenden und rekonstruktiven Architektur propagieren? „Die Antwort lautet unweigerlich in den Sieger. […] Wer immer bis zu diesem Tage den Sieg davontrug, der marschiert mit in dem Triumphzug, der die heute Herrschenden über die dahinführt, die heute am Boden liegen. Die Beute wird, wie das immer so üblich war, im Triumphzug mitgeführt. Man bezeichnet sie als die Kulturgüter.“03
Nicht von ungefähr heißt es heute immer dann Baukultur oder noch hochtrabender Stadtbaukunst, wenn man den ideologischen Sieg davontragen will. Doch eine reine Kultur, an die man schuldlos anknüpfen könnte, gibt es nicht, wie Benjamin an derselben Stelle klarmacht: „Es ist niemals ein Dokument der Kultur, ohne zugleich ein solches der Barbarei zu sein.“04 Diese Dialektik der Geschichte wollen die Rekonstruktionsbefürworter*innen nicht wahrhaben.
Wie das Beispiel von Hans Kollhoffs Walter-Benjamin-Platz zeigt, scheint die Architektur seismografisch Entwicklungen vorwegzunehmen, die wir gemeinhin mit dem Erstarken der Neuen Rechten in den letzten Jahren in Verbindung bringen, die jedoch so neu nicht ist, wie Stephan Trüby, der das Projekt „Rechte Räume“ initiiert hat, in seinem Grundlagenbeitrag herausarbeitet. Die architekturpolitische Ideologisierung mit der nationalkonservativen Wende der sogenannten Berlinischen Architektur, auf die ARCH+bereits 1994 (also in dem Jahr, in dem das Benjamin-Denkmal in Portbou eingeweiht wurde) mit dem Heft Von Berlin nach Neuteutonia aufmerksam gemacht hat, geht der neurechten Entwicklung in der Gesellschaft Jahrzehnte voraus. Neu ist an der Neuen Rechten allenfalls die strategische und qualitative Veränderung, die den Rechtsextremismus normalisiert. Neu ist vor allem, dass sie ihre alten Rassismen, ihr altes Überlegenheitsgefühl, ihren alten Patriarchalismus, ihren alten Antisemitismus mit pseudo-fortschrittlichen Argumenten verbrämt: Ihre angebliche Sorge um die liberalen Werte des Abendlandes verbrämt die Islamfeindlichkeit, ihr angeblicher Schutz der Natur verbrämt das völkische Denken, ihre angebliche Verteidigung der natürlichen Geschlechterordnung verbrämt die tiefsitzende Misogynie und Homophobie. Sie ist sich nicht zu blöde, sich mit rassistischen Wahlplakaten als Beschützerin von Frauen und Homosexuellen auszugeben. Indem sie sich betont abendländisch tolerant und kulturbeflissen gibt, will sie die vermeintliche Unverträglichkeit anderer Kulturen, vorzugsweise des Islam, mit der europäischen Kultur und ihren Freiheitsidealen unterstreichen. Die Perfidie des autoritären Toleranzgebots der Neuen Rechten lautet: Ihr dürft gerne anders sein. Nur nicht bei uns. Der identitäre „Ethnopluralismus“ ist eine feinere Art zu sagen: Haut ab! Geht dahin zurück, wo ihr hergekommen seid!
In ihrem Triumphzug führt die Neue Rechte als Beute die Baukultur als identitätspolitisches Programm mit. Damit dringt sie tief in die bürgerliche Mitte ein, schließlich ist niemand gleich rechts, nur weil er oder sie Rekonstruktionen schön findet. Deswegen war auch unser Aufruf zu einem Rekonstruktions-Watch im Sinne einer ideologischen Wachsamkeit gegenüber dem politischen Subtext solcher Projekte auf heftige Kritik gestoßen von Leuten, die sich nicht dem rechten Milieu zuordnen. Doch damit gehen sie den Rattenfängern auch schon auf dem Leim, die mit Begriffen wie „Schönheit“ und „europäische Stadt“ wirkungsvolle Nebelkerzen zünden. In diesem Zusammenhang wird deutlich, dass das nebulöse Label der europäischen Stadt von Anfang an anschlussfähig für das identitäre Programm der Neuen Rechten war. Es ist kein geringerer als Claus Wolfschlag, jener in stramm rechten Kreisen publizierende Mitinitiator der Rekonstruktion der Frankfurter Altstadt, der, wie Trüby dies in seiner Recherche dargelegt hat, die Notwendigkeit unterstreicht, das Feld der Architektur für die Rechte zu vereinnahmen: „[W]er von Volk oder Heimat reden will, kann von der Architektur (in und mit welcher das Volk ja schließlich lebt) wohl nicht schweigen.“05 Diesen Zusammenhang leugnen alle, die die Frankfurter Rekonstruktion entweder politisch oder stilistisch, aus Opportunismus oder aus „Trägheit des Herzens“ (Benjamin) gar nicht so schlimm finden. Dass es mit Volk und Heimat nicht so weit her ist, wird deutlich, wenn man die Ökonomie dahinter betrachtet, wie dies Philipp Oswalt getan hat. Hier wurden mit hunderten von Millionen öffentlicher Gelder hochsubventionierte Räume für betuchte Bürger*innen geschaffen. Hier wurde mit der immobilienwirtschaftlichen Logik der Knappheit gehandelt.06 Dies zeigt die soeben veröffentlichte „Düsseldorfer Erklärung zum Städtebaurecht“, hinter der Christoph Mäcklers sogenanntes „Deutsches Institut für Stadtbaukunst“ steht. Dieser Hort der reaktionärsten Kräfte des deutschen Architektur- und Stadtdiskurses propagiert mit viel Tamtam die Abschaffung der Dichteobergrenzen im § 17 der Baunutzungsverordnung. Die Immobilienwirtschaft hat ganze Lobbyarbeit geleistet und lacht sich nun ins Fäustchen. Deren unheilige Allianz mit der Architektenschaft macht sich für beide Seiten bezahlt. Die ökonomischen und sozialen Bedingungen, unter denen die heutige Stadt gebaut wird, werden geflissentlich ausgeblendet. Wer sich diese Stadt leisten kann und was für eine Gesellschaft das ist, die darin lebt, wird verschwiegen. In letzter Konsequenz wird hier zu Gunsten der Baufreiheit das Ideal der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse aufgegeben. Beschämend, dass sich neben den üblichen Verdächtigen ein Großteil der Planungspolitik der Bundesrepublik für einen solchen Unfug hergibt.
Und dass es auch mit der Ehrfurcht vor der Geschichte der europäischen Stadt nicht so weit her ist, zeigt die Fotoarbeit des Künstlers Daniel Poller in dieser Ausgabe. Er fotografierte jene Spolien, die Trophäen gleich in die Gebäude eingesetzt wurden, um die Historizität des Gebauten zu suggerieren. Die Arbeit macht den Verlust aller bauhistorischen, konstruktiven und gesellschaftlichen Bezüge der überkommenen Fragmente historischer Gebäude deutlich. Die Rekonstruktion wird als traditionslos entlarvt.
Was tun? Die Aufgabe ist es, um Benjamin das letzte Wort zu geben, „die Geschichte gegen den Strich zu bürsten.“07
Das ist das Ziel dieser Ausgabe.
ARCH+ Team: Nora Dünser, Alexandra Nehmer, Frederick Coulomb, Mirko Gatti, Dorothee Hahn, Max Kaldenhoff, Melissa Koch, Jann Wiegand
Ich danke der Gastredaktion um Stephan Trüby und dem Team des IGmA der Universität Stuttgart, insbesondere Philipp Krüpe und Matteo Trentini, für den Mut und langen Atem bei der gemeinsamen Bearbeitung dieses wichtigen Themas. Markus Miessen danke ich für die Plakataktion, die auf den Skandal der Gestaltung des Walter-Benjamin-Platzes aufmerksam macht. Ein besonderer Dank geht an die Bundeszentrale für politische Bildung, die die Veranstaltung des ARCH+ Vereins und des IGmA zur europäischen Situation der rechten Räume in der Volksbühne fördert.
01 Walter Benjamin: „Geschichtsphilosophische Thesen“, in: ders.: Zur Kritik der Gewalt und andere Ansätze, Frankfurt a. M. 1965 [verfasst um 1938/40, posthume Erstausgabe 1950], S. 78–94, hier S. 82
02 Ebd.
03 Ebd., S. 83
04 Ebd.
05 Claus-M. Wolfschlag: „Heimat bauen – Für eine menschliche Architektur“, in: Andreas Molau (Hg.): Opposition für Deutschland – Widerspruch und Erneuerung, Berg am See 1995, S. 113–51, hier S. 114
06 Philipp Oswalt: „Vorbild Frankfurt – Restaurative Schizophrenie“, in: Merkur, 27.8.2018, www.merkur-zeitschrift.de/2018/08/27/architekturkolumne-vorbild-frankfurt-restaurative-schizophrenie/ (Stand: 7.5.2019)
07 Benjamin 1965 (wie Anm. 1), S. 83
Die Quelle und der Link zum Heft: Hier
Sehen Sie im Link auch die Inhaltsangabe des Heftes und insbesondere (für meine Belange) den Artikel „Die Countryside als Politisches Projekt“ von Joe Kennedy, Seite 200 – 205. Mich faszinierte das besonders, weil die Lektüre mich zurückführte auf das kleine Buch von John Berger, das ich vor genau 45 Jahren mit Begeisterung studiert habe.
Quelle John Berger: Sehen / Das Bild der Welt in der Bilderwelt / Sachbuch rororo Rowohlt Reinbek bei Hamburg 1974 / Eine schönere Version des obigen Bildes:
 siehe Wikipedia hier
siehe Wikipedia hier
(Fortsetzung folgt)