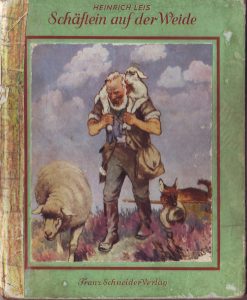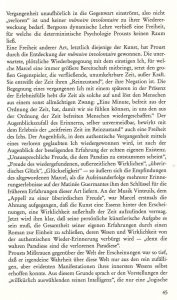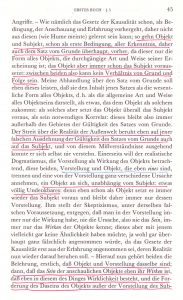Vom Geschmack (Geruch) der Vergangenheit
Wer noch nie Marcel Proust gelesen hat, nicht einmal wenige Seiten, der hat doch zumindest vom Madeleine-Erlebnis gehört, das wie ein psychologisches Faktum weitergereicht wird: der Geschmack eines Gebäcks, von dem man kostet, nachdem man es in den Tee getaucht hat, löst eine ferne Erinnerung aus. Diesen Geschmack kennt man aus der Kindheit und damit ist eine Brücke geschlagen, die Situation von damals scheint plötzlich wieder greifbar nah und löst einen wehmütigen Schock aus.
Mir ist dazu meist etwas leicht Unpassendes eingefallen, der Stallgeruch nämlich, der mich wohlig umfing, wenn ich das Haus meiner Großeltern von der Gartenseite aus betrat; die Tür dort war fast nie verschlossen, weil niemand unbefugt das Grundstück hätte betreten und schon gar nicht von dort aus in den Kuhstall vordringen dürfen. Uns Enkelkindern war es erlaubt, hier begann unsere Zeit der Freiheit auf dem Lande. Mein erster Weg war – vorbei an den Kühen – zu dem Koben, in dem das Schaf stand, das ich mir persönlich zuordnete; es trug den Namen, den ich ausgesucht hatte: Molli. Ich kannte es aus der Zeit, als es ein Lämmchen war, aber diese Geschichte wäre jetzt zu lang, der Name stammte jedenfalls aus einem Kinderbuch, das ich bis heute aufbewahrt habe. Aber ich brauche eigentlich nur den Geruch, und er muss nicht einmal auf die Nuance genau stimmen; es genügt, wenn ich an einem Zirkus vorübergehe, der mit Pferden arbeitet: schon ist die Kindheit wieder da.
Bei Marcel Proust ging es feiner zu, aber ich glaube, der Dichter hätte meine Erinnerung genau so sorgfältig behandelt wie den Duft des Tees, den Geschmack der Madeleine bei seiner Mutter bzw. einst bei Tante Leonie. Im folgenden Artikel ist detailliert davon die Rede.
ZITAT
Marcel Prousts „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ zählt zu den Klassikern gastrosophischer Literatur. Gastautorin Martina Kopf erklärt uns noch einmal warum – selbst wenn der Tee nicht schmeckt.
https://www.tartuffel.de/artikel/proust-vom-geschmack-der-vergangenheit/ HIER
Autorin: hier
Angenommen, ich wollte eine ähnliche Verbindung zur Kindheit evozieren, gäbe es viele Punkte, um anzudocken, und ich könnte sie wohl auch, wenn ich der Phantasie freien Lauf ließe, in einen quasi numinosen Rang erheben. Ich bemerke einerseits den Drang, sie realitätsgerecht zu datieren, und könnte mich dabei auf alte Briefe oder Kalendereinträge stützen, bin aber andererseits oft entsetzt, wie naiv ich in jener Zeit dachte: ich will so nicht gewesen sein, obwohl mir das was ich im „aktuellen“ Kopf aufrufe, durchaus mit dem Kopf von damals in einem engen, ernstzunehmenden Konnex zu stehen scheint. Wie merkwürdig das kleine Buch vom „Schäflein auf der Weide“ den Sprung vom Lande nach Bielefeld geschafft hat, die Aufschrift Große Kurfürstenstraße stammt wohl von meinem Vater, den Stempel Paulusstraße 30 habe ich selbst hineingedrückt, als ich mindestens schon 10 war, „mein“ Schaf Molli war längst eine Erinnerung, wir trafen uns in Misburg wieder: mein Großvater mütterlicherseits hatte es wider jede Hoffnung an die Familie der „anderen“ Großmutter verkauft, es gehörte jetzt zum wilden Paradies „Am alten Saupark“, wo ich gerne Ferien verbrachte. Das Gefühl, die Mutter zu verlieren, war mir bekannt, ein entsprechendes Bilderbuch gab es auch: „Vom Engelchen, das seine Mutter suchte“. Und im Schulbuch meines Bruders las ich die kurze Geschichte eines Kindes, das vergessen hatte, wie die Mutter aussah; weinend eilte es nach Hause, um sich zu vergewissern, ob sie noch existierte und konnte beruhigt in die Schule zurückkehren. Für mich jedoch blieb die Vorstellung ein Quell der Beunruhigung, es musste ja nicht immer so ausgehen. In diesem Bilderbuch nun war ich mal das Schäfchen, mal der wachsame Schäferhund. Letztenendes ging ich selbst verloren. In der Wirklichkeit entstand plötzlich ein dünnes Gefühlsband zwischen den beiden Familienstämmen aus Pommern und aus Westfalen…
Das Büchlein barg – bei scheinbarer Idylle – für das Kind eine mythische Dramatik: ein wolfsähnlicher Feind-Hund taucht auf, das Schäfchen verirrt sich in der Natur. Das einzige Bild, das ich abgepaust habe (damals große Mode unter Kindern), war das mit der Eule im nächtlichen Walde. Vielleicht um die Angst zu bannen?
 Von der Angst im Unbekannten
Von der Angst im Unbekannten Ein Schein von realem happy end
Ein Schein von realem happy end
Mollis Übergabe in Misburg 1948, sie lernt die dort ansässige Ziege Röschen kennen.
Der Krieg und die Flucht der Familien aus Pommern (und aus dem Harz) liegen erst drei Jahre zurück. Die einzige Westfälin auf diesem Foto ist meine Mutter (die zweite von rechts) und eben – Molli.
Und wie komme ich nun auf große Literatur?
* * *
Schwer zu sagen, warum einige Jahre später mit neuen Sehnsüchten und Empfindungen auch wieder diffuse Todesgedanken auftauchen, Verlustängste, und zwar deutlicher, dringlicher als in den Tagen der Kindheit, als sie mit dem Eintreffen (oder der Gegenwart) der Mutter beschwichtigt wurden. Jetzt, mit der Nähe eines anderen (ungewissen) Ichs ist man sich auch des eigenen Ichs noch weniger sicher. So erkläre ich mir, dass ein bestimmtes Gedicht mich intensiv beschäftigte, und – schwer zu deuten – doch zugleich Widerstand leistete und mich im Stich zu lassen schien. Kein Trost. Gedanken eines anderen, die mir sagten, dass es keinen Ausweg gebe. Und es ging nicht mehr um die Mutter.
Die Anfangszeilen habe ich von Anfang an geliebt, selbst als ich noch nie Atem zum Erinnern auf den Wangen gespürt hatte, nur wünschte, dass es soweit kommen möge.
Noch spür ich ihren Atem auf den Wangen:
Wie kann das sein, daß diese nahen Tage
Fort sind, für immer fort, und ganz vergangen?
In den nächsten Zeilen hätte ich zugestimmt, fand aber das Wort „grauenvoll“ etwas übertrieben. Dann: dass mir mein Ich von einst so fremd sein könnte „wie ein Hund“, – nein, warum gerade dieses Wort, da ich doch dazu neigte, mich jedem Hund, jeder Katze irgendwie nahe zu fühlen. Auch der Vers mit dem Totenhemd behagte mir nicht. Noch weniger der mit dem eignen Haar, das man allzuleicht verliert. Gewiss, die Ahnen und mein Ich – vor hundert Jahren, – das konnte passen, damals wie heute.
Noch spür ich ihren Atem auf den Wangen: Wie kann das sein, daß diese nahen Tage Fort sind, für immer fort, und ganz vergangen? Dies ist ein Ding, das keiner voll aussinnt, Und viel zu grauenvoll, als daß man klage: Daß alles gleitet und vorüberrinnt. Und daß mein eignes Ich, durch nichts gehemmt, Herüberglitt aus einem kleinen Kind Mir wie ein Hund unheimlich stumm und fremd. Dann: daß ich auch vor hundert Jahren war Und meine Ahnen, die im Totenhemd, Mit mir verwandt sind wie mein eignes Haar, So eins mit mir als wie mein eignes Haar.
Die anderen Versgruppen unter II und III habe ich mir ganz und gar nicht zueigen gemacht. Der Traum ein Leben, das Leben ein Traum, sowas war mir zu literarisch, außer bei Tschuangtse. Aber ich hätte das vielleicht nicht laut gesagt, nur darauf hingewiesen, dass es von Rilke und Trakl Gedichte gab, die für mich von der ersten bis zur letzten Zeile der Wahrheit entsprachen.
Zu Proust: Sobald Erich Köhler im Zusammenhang mit Proust auf „Zeit und Erinnerung“ kommt, spricht er über Mutter und Großmutter, die im Roman zu einer einzigen Person zusammenfließen, zugleich aber auch von einer Beschämung. Ich halte an und und versuche zu verstehen, warum ich „in eigener Sache“ zu anderen Folgerungen komme: da gibt es auch ein Schuldgefühl, das aber bei näherer Betrachtung auf einer Schuld der anderen beruht, zwei Bestrafungsaktionen, Erziehungsmaßnahmen, Demütigungen, die ich heute keineswegs billige, als Viereinhalbjähriger (Mutter) oder Achtjähriger (Vater) aber natürlich nicht im geringsten in Frage gestellt habe. Das Schuldgefühl kommt daher, dass ich, sobald ich die (unbezweifelbare) Liebe meiner Eltern in Erinnerung rufe, unweigerlich sofort um diese Szenen kreise. Dies nur zur Erklärung, wenn ich – von Prousts Schuldgefühlen lesend – ohne jede Empathie bleibe und seine Erinnerungstheorie, die ich vor 50 Jahren für bare Münze genommen habe, gleich mit kritisiere. Hier das entsprechende Zitat:
Proust hat seiner Mutter in der Recherche ein Denkmal gesetzt, an dessen Erstellung die tiefste Verehrung eines seelisch immer irgendwie ein Kind gebliebenen Mannes und das Schuldgefühl eines höchst sensiblen Erwachsenen beteiligt sind. Ihr Bild ist auf zwei Personen verteilt: Marcels Mutter und Großmutter. Immer, wenn Marcel an die letztere denkt, nimmt er mit Beschämung wahr, daß diese Erinnerung kein tiefes Gefühl in ihm wachruft, daß selbst das Ich, das die Großmutter liebte, tot ist. Als er jedoch beim zweiten Aufenthalt in Balbec im Hotelzimmer sich bückt, um sich seiner Schuhe zu entledigen, weitet sich plötzlich die Brust durch die Gegenwart des Wesens, das ihm einst im gleichen Zimmer, als er ebenso körperlich leidend war wie jetzt, beim Ausziehen behilflich war. Das zärtliche, besorgte Gesicht der Großmutter ist wieder gegenwärtig als „lebendige Wirklichkeit in einer unwillkürlichen Wieder-Erinnerung“. „Das Ich, das ich damals war, so lange entschwunden, war mir aufs neue ganz nahe.“ Freilich, jetzt erst wird Marcel ganz bewußt, daß er die Großmutter verloren hat, jetzt erst ist ihr Tod wirklich, gemäß jenem „Anachronismus, der es so oft verhindert, daß der Kalender der Tatsachen sich mit demjenigen des Gefühls deckt“.
Quelle Erich Köhler: Marcel Proust ZITAT a.a.O. Seite 43 / und weiter hier:
Damals habe ich das so übernommen, wie ich es las: „Das Ich, das ich damals war, so lange entschwunden, war mir aufs neue ganz nahe.“ So bei Proust, und ich las es als Überbietung, nein, Korrektur der Hofmannsthal-Verse: „Und daß mein eignes Ich, durch nichts gehemmt, / Herüberglitt aus einem kleinen Kind / Mir wie ein Hund unheimlich stumm und fremd.“ Und dachte auch an Rimbaud’s „Je suis un autre“. Habe ich es vielleicht nur hingenommen, weil es zur Moderne gehörte, zur Zersplitterung jedes höheren Zusammenhangs. Und genauso hätte ich es bei Erich Köhler verstanden:
Der psychische Pluralismus ist auch ein solcher der Zeit. Den Ich-Parzellen entsprechen die Zeit-Parzellen, dem vase clos des Ich der temps clos. Da bereits das Ich des nächsten Augenblicks unvorhersehbar, die Zukunft daher verschlossen ist, kann eine Gewißheit nur in der Vergangenheit aufgesucht werden. der versuch freilich, sie durch eine Anstrengung des Willens wieder lebendig werden zu lassen, scheitert, weil das evozierte einstige Ich durch die Vorstellungen des gegenwärtigen Ich verfälscht wird. Es bedarf einer spontanen Erinnerung, um das dem Vergessen anheimgefallene einstige Ich aus dem Unterbewußten wieder zu erwecken. Die Leistung der mémoire involontaires ist es, durch das „Wunder einer Analogie“ ein vergangenes mit dem gegenwärtigen Ich in eine Beziehung zu setzen, die den Inhalt beider als wahr und wirklich erweist, eben weil die Wiedererweckung über eine Sinnesempfindung und ohne Zutun des Willens erfolgt. Der Zufall ist der „Stempel ihrer Authentizität“. [s.o. Köhler Seite 44]
Ich muss mühsam den Gedanken an die Inthronierung des Zufalls bei John Cage zurückdrängen („keine likes oder dislikes“!). Warum will ich denn partout jede konstruktive Nachhilfe des menschlichen Gehirns ausschalten, als könne ich verhindern, dass der Zufall nicht sogleich wieder einer ähnlichen Prozedur unterzogen wird? Woher die manische Suche nach Erlebnissen des Eintauchens, nur um Gottes willen – ohne der Selbsttäuschung Vorschub zu leisten, allein der Zufall soll gelten!
Daß die Momente des Erinnerns und des Erinnerten analog bis zur Identität sein können, ist die Signatur ihrer Realität: Sie erschließen die „Essenz der Dinge“. Erkennen wird nur durch Wieder-Erkennen möglich. Die wiedererinnerten Ichs und ihre Koordinaten von Zeit und Raum setzen in die Nacht der Vergangenheit Lichtpunkte, die dem rückschauenden Blick die anders immer verschlossene Wahrheit über die eigene Person und seine Erfahrungen erhellen. [a.a.O.]
Wieso kann man nicht – statt der „Essenz“ den grundlegendsten philosophischen Gedanken in Erwägung ziehen, seine Gültigkeit anerkennen, und das Leiden daran gerade nicht aufheben zu wollen, weil es zugleich unser größtes Glück beinhaltet: die Freiheit.
Ich rede von der Subjekt-Objekt-Spaltung. Hier stehe ich mit hellem Bewusstsein und dort trifft es auf einen Gegenstand, mit dem ich nicht eins werden kann. Es sei denn, ich lösche es aus, – vielleicht mit einem Liter starken Weins? Will ich das denn? Wache ich nicht morgen früh wieder auf, froh, in den Zustand der Spaltung zurückzukehren?
Ich bin zweifellos mehr auf der Seite der Philosophie als auf der des Dichters. Und Köhler selbst schreibt: Proust
verwahrte sich gegen die Auffassung, daß sein Roman eine künstlerische Illustration der Philosophie Henri Bergsons sei. In der Tat ist Prousts atomistische Zeitauffassung grundverschieden von Bergsons „Dauer“, die Diskontinuität der „inneren“ Zeit steht im Widerspruch zu Bergsons „Lebensstrom“, mit dem die Vergangenheit unaufhörlich in die Gegenwart einströmt, also nicht „verloren“ ist und keiner mémoire involontaire zu ihrer Wiedererweckung bedarf. Bergsons dynamische Lehre verhieß eine Freiheit, für welche die deterministische Psychologie Prousts keinen Raum ließ.
Eine Freiheit anderer Art, letztlich diejenige der Kunst, hat Proust durch die Entdeckung der mémoire involontaire gewonnen. Die unerwartete, plötzliche Wiederbegegnung mit dem einstigen Ich, für welche Marcel eine immer größere Bereitschaft mitbringt, setzt den großen Gegenspieler, die verfließende, unumkehrbare Zeit, außer Kraft.
Für diese subkutane Ermunterung, Prousts „Philosophie“ als die eines Dichters nicht allzu verbindlich aufzufassen, darf man Köhler dankbar sein. Ich kehre also gestärkt zu Hegel zurück, dessen erstes „Pänomenologie“-Kapitel genau das zu klären sucht, was ich hier (nach Karl Jaspers) als Subjekt-Objekt-Spaltung bezeichnet habe. Ich vermute, dass Proust bei aller Hochschätzung seines Scharfsinns – doch näher am „populären Denken“ steht – einem „realistischen“ Prinzip – wie wir es bei Hegel gründlich beschrieben finden, und das tatsächlich für den Schriftsteller eine geradezu unvermeidbare Attraktion behalten muss. Bei Hegel aber beginnt die Schwierigkeit damit: zu begreifen, dass diese Subjekt-Objekt-Spaltung nicht etwa überwunden oder harmonisiert werden kann oder soll, sondern – dass sie gar nicht vorhanden ist, das Objekt ist im Subjekt enthalten und umgekehrt: das Objekt ist selber ein Subjekt. Ein reziprokes Verhältnis wie Herr und Knecht.
Memento: nicht das principium individuationis verwechseln mit dem Begriff der Subjekt-Objekt-Spaltung, was ja durchaus denkbar wäre, wenn man das Individuum dem Anderen gegenübergestellt sieht, als Ent-zweiung. Man bedenke diesen Satz: „Die Frage nach dem Individuationsprinzip wird in allen Philosophien zum Problem, die nicht anerkennen, dass die objektive Realität grundsätzlich durch konkrete und individuelle Formen existiert, insofern sie das Allgemeine als das Ursprüngliche überbewerten und als den eigentlichen Seinskern im Seienden ansehen.“ Ein guter Satz!!! Siehe Wikipedia hier.
Schopenhauer dagegen: Vorstellung und Objekt, die eben eines sind…
Arthur Schopenhauer: Welt als Wille und Vorstellung Erstes Buch § 5