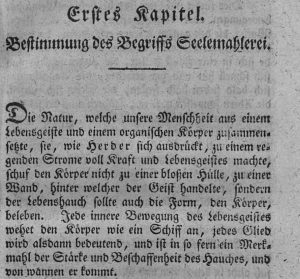Der Blick aus dem Fenster im 5. Stock der Klinik, in Richtung „Heimat“.
Dieses im Sinn, möchte ich über eine mir bis dahin unbekannte Musik sprechen, die ich erstmalig, aber dann sehr oft gehört habe, um in ihr heimisch zu werden. Sie erinnerte mich an Froberger, an bestimmte Préludes, die nicht mensuriert sind. Die Chance, ein solches notiertes, aber nicht rhythmisch präzise ausgeformtes Stück nur über das Ohr als sinnvolle Musik zu erfassen, schien mir von Wiederholung zu Wiederholung reizvoller. Zugleich war ich durch eine bestimmte Lektüre angeregt, nämlich durch die Theorie der Resonanz, die Hartmut Rosa in dem Büchlein „Unverfügbarkeit“ dargestellt hat. Ich wollte erkunden, ob sich in der Verbindung mit dieser unbekannten Musik, so etwas wie eine Resonanzerfahrung bilden wird, oder eine instinktive Verweigerungshaltung genährt wird, die ich anfangs spürte.
Dies geschah in der Klinik, wo ich – mattgesetzt – nichts anderes als diese Musik, deren Komponist mir unbekannt war, auf dem Handy abrufen konnte.
Nach Haus zurückgekehrt, versuchte ich jetzt, dieses Stück auf Youtube zu finden, stieß auf eine andere Interpretation, die mit dem parallel zum Spiel wiedergegebenen schriftlichen Ablauf des Werkes versehen ist. Man kann also die Noten mitverfolgen. Trotzdem will ich zunächst den Eindruck festhalten, der vor der Kenntnis des Notentextes entstanden war.
Es ist wohl ein Unterschied, der auch bei Theorien des Hörens beachtet werden müsste: was steht im Vordergrund? Sehe ich die reale Aufführung, also einen spielenden Menschen, sehe ich die Noten, oder höre ich mit Kopfhörern nur das tönende Werk?
Zurückgestellt sei die Frage: Was sollte ich über den historischen Hintergrund wissen (Versailles, Agréments der Zeit), um in der stilistischen Einordnung vorweg einige Weichen zu stellen? Wer grundsätzlich etwas gegen überbordendes „Getriller“ hat, sollte das Defizit zunächst bei sich selbst suchen: er wird vielleicht schon beim Thema der Bachschen Goldberg-Variationen anderen Sinnes und sich ärgern, wenn er z.B. Wilhelm Kempffs „abgespeckte“ Version als seriöse Alternative betrachten soll. (Natürlich hat ein Ornament absolut nichts mit „Speck“-Ansatz zu tun, im Gegenteil: mit Auflockerung der Strukturen.)
ZITAT Wikipedia „Verzierung“:
Frankreich, seit der Zeit Ludwigs XIV. kulturell stilprägende Nation, wartete mit dem größten und am feinsten ausgearbeiteten Fundus an wesentlichen Verzierungen auf: Die größte bis dahin veröffentlichte Verzierungstabelle (mit insgesamt 29 Verzierungsarten) stammt von Jean-Henri d’Anglebert in seinen Pièces de clavecin von 1689. Sehr einflussreich waren auch François Couperins Verzierungen in seinen vier Bänden mit Pièces de Clavecin, von denen der erste 1713 herauskam. In Italien, das der übrigen europäischen Musik schon länger als Vorbild diente, kamen zu diesen wesentlichen Manieren und Trillern noch die improvisierten oder willkürlichen Verzierungen, die sich vor allem durch die Diminution der jeweils gegebenen Melodik ergaben. Seit der Wiener Klassik wurde die improvisatorische Verzierung des Notentextes durch den Interpreten immer bedeutungsloser, da Komponisten ihre Vorstellungen immer exakter notierten.
Ich erinnere mich mit Dankbarkeit an bestimmte musikalische Erfahrungen der 1960er Jahre: zunächst einmal an die entnervenden Mahnungen des Kammermusiklehrers Günter Kehr: „Nicht zusammen, nochmal! – Nochmal!“ usf. bei Akkordschlägen, wo wir (als Klaviertrio oder Streichquartett) schon ziemlich zufrieden waren; Kehr aber – als alter „Rundfunkhase“, hatte schon viel Erfahrung mit Aufnahmepraxis, also mit der Unbestechlichkeit der Mikrofone. Darüberhinaus rühmte er das Rubatospiel unseres Pianisten Christian de Bruyn, während man als Streicher glaubte, die Kunst der Melodiegestaltung per Intuition gepachtet zu haben. Lauter Lernprozesse. Viel später kam für mich die Begegnung mit der indischen, der arabischen oder der iranischen Musik, – wo sich zeigte, wie berückend die Kehrseite der gerade dort hochentwickelten Rhythmik wirkte: das vom regulären Rhythmus befreite Schweifen im indischen Alap, im arabischen Taqsim oder auch in der tunesischen Nuba-Einleitung „Istiftah“, wo das Orchester fern jeder „preußischen Disziplin“ agierte. Kein Vorbild natürlich für ein historisch orientiertes Ensemble wie das Collegium Aureum. Aber dann kam Gustav Leonhardt, seine Durchleuchtung der alten französischen Musik, der Swing des inegalen Spiels von Sechzehnteln und auch des absichtlich ungleichen Anschlags genau untereinander notierter Akkorde, das „non-mensuré“, das übrigens wenig zu diesem noblen Künstler zu passen schien. Heute schaut man bei Wikipedia nach und findet auf Anhieb etwa dies oder besser dies. Aber wohlgemerkt: man lernt es nicht im herkömmlichen Kammermusikensemble. Daher das umwerfende Erlebnis für mich, die Aufnahmen des Alarius-Ensembles mit Sonaten des Hochbarock im provisorischen Technikraum von Schloss Kirchheim mithören zu dürfen: dass man sich in der Alten Musik so frei bewegen konnte!
All dies ging mir jetzt durch den Kopf, als ich das unbekannte Praeludium in den glasklaren, bezaubernden Klängen eines französischen Cembalos in ihrer Konstruktion zu durchschauen suchte, und zwar wie mit fremden Ohren: diesen Frühlingsregen von scheinbar ungeordneten Tönen, die doch ohne Zweifel einem Konzept von regulären, kunstvoll verzögerten und verhüllten Akkordfolgen gehorchten. Es könnte Menschen geben, die davon nervös werden. Oder sich hemmungslos faszinieren lassen. Es hat nicht nur mit einer besonderen Raffinesse der 10 Finger auf den zahllosen Tasten zu tun, sondern genauso mit der Bereitschaft des Gehörs, sich „spielerisch“ in dieses von jenen geschaffene Labyrinth hineinzubegeben.
Andererseits der Zweifel, ob diese neue Erfahrung mit den Lernprozessen von früher vergleichbar ist, ob ich dieser speziellen Aufnahme in ihrer Abstrakheit (auf meinem Handy) näherkomme als mit einem Studium von Vergleichsaufnahmen; oder ob es beliebiger wird. Ob ich nicht Belehrung durch den Künstler selbst abwarten sollte, mit andern Worten: ich brauche das das Booklet (natürlich: inzwischen ist die physische CD bestellt, hier also mit Andreas Gilger).
Der Klinik entronnen, haben sich meine Vorsätze und halb unfreiwilligen Eingrenzungen verändert. Bevor ich mich weiter ins Detail versenke, will ich den Horizont abschreiten:
Wie war das Leben in Versailles, wie wurden Feste gefeiert? ich schaue nach bei Wikipedia HIER.
Welche Rolle spielte dort der Komponist Jean-Henri d’Anglebert?
Am 25. August 1668 verpflichtete sich d’Anglebert in einem weiteren Abkommen mit Chambonnières für dessen Amt als königlicher porte-épinette („Cembaloträger“), die Kosten für den Transport des Cembalos zu übernehmen „… wo es für den Dienst seiner Majestät nötig ist …“. Erst nach dem Tode Chambonnières’ übernahm d’Anglebert offiziell das Amt als Cembalist am Hofe Ludwigs des XIV. Diese Stellung übergab er bereits zwei Jahre später (1674) offiziell seinem ältesten Sohn Jean-Baptiste Henry (1661–1735), der zu dieser Zeit erst 13 Jahre alt war.
Einstweilen höre ich schon mal eine andere Aufnahme, die mir erlaubt, einen Notentext mitzulesen (was ich mir eigentlich versagen wollte). Der Interpret ist Christophe Rousset:
Um alle Stücke dieser Reihe vor sich zu sehen und gezielt zum Hören auszuwählen, gehen Sie bitte hierher.
(Fortsetzung folgt – also auch noch)
2. April 2022 Ich werde diesen Vergleich, so beflügelnd er wirkte, nicht weitertreiben. Die besondere Wirkung lag vielleicht darin, dass ich mich der (neuen) Musik von Jean-Henri d’Anglebert fast ausschließlich mit Kopfhörern nähern musste, was tatsächlich eine besondere Art des Eintauchens förderte und andere Motivationen abbremste. Heute ist die physische CD eingetroffen und bestätigt mir alle Rahmenbedingungen, die ich der Musik zubillige. Beziehungsweise: deren Beitrag zum rein inhaltlichen Hören ich für notwendig halte. Ich will das Wort „adäquat“ nicht benutzen, denn kein gelesenes Faktum kommt wesentlich, als ein neues, hinzu, über das ich nicht vorher schon irgendwie verfügt hätte, sagen wir: seit ich die Bedeutung der Rhetorik ernst nehme, also spätestens seit Harnoncourts Buch von der „Klangrede“ und der damit hervorgerufenen Sekundärliteratur. Aber trotz aller Lully-Molière-Inszenierungen, der frühen Begegnung mit Südfrankreich, mit Campra z.B., niemand hatte bisher den Namen Le Brun ins Spiel gebracht und das ist der zündende Funke. Dieses Neue hatte ich unter den Kopfhörern (Ohrstöpseln) des neuen Handys wahrgenommen, ich hatte den Wunsch, auch das Cembalo zu sehen, das diese phantastischen Klänge hervorzauberte. Warum sollte ich mich nicht mit Energie auf die Nachzeichnung der Passionen einlassen. Schließlich liegt die Klinik samt knallrot untergehender Sonne weit genug entfernt…
 nach Original von Vaudry Paris 1681
nach Original von Vaudry Paris 1681
(Fortsetzung? wie gesagt: hier)