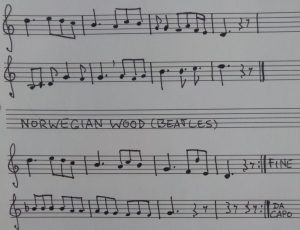Architektur und Musik
Z W E I Z I T A T E
RAUM
Die Architektur schafft den Schein jener Welt, die das Gegenüber eines Selbst ist. Sie ist das Sichtbarwerden einer vollständigen Umwelt. Dort wo das Selbst ein kollektives ist, wie in einem Stamm, ist seine Welt eine gemeinschaftliche; für das persönliche Selbstsein ist es das Heim. So wie die reale Umwelt eines Geschöpfs ein System funktionaler Beziehungen ist, so ist eine virtuelle „Umwelt“, der geschaffene Raum der Architektur, ein Symbol funktionaler Existenz. Das heißt nun freilich nicht, dass Zeichen von wichtigen Tätigkeiten – Haken für Gerätschaften, bequeme Bänke, durchdachte Türen – in seinen Sinngehalt eingehen. Auf dieser falschen Annahme gründet der Irrtum des Funktionalismus – nicht dass er sehr tief ginge, vermutlich geht er nur so tief wie die Theorie selbst. Der symbolische Ausdruck ist meilenweit entfernt von vorausschauender Planung oder einer gelungenen Anordnung. Er verweist nicht auf etwas, das hier oder dort verrichtet werden soll, vielmehr verkörpert er das Gefühl, den Rhythmus, die Leidenschaft oder Nüchternheit, die Leichtfertigkeit oder Furcht, mit der überhaupt etwas verrichtet wird. Das ist das Bild des Lebens, das in den Bauwerken geschaffen wird, es ist der sichtbare Schein eines „sozio-kulturellen Gebiets“, das Symbol des Menschseins, das sich in der Kraft und dem Zusammenspiel der Formen niederschlägt.
Weil wir Organismen sind, entwickeln sich alle unsere Handlungen in organischer Weise; die Struktur unserer Gefühle wie auch unserer körperlichen Akte ähnelt einem Stoffwechsel. Systole, Diastole; Aufbauen, Abbauen; Crescendo, Diminuendo. Manchmal auch Aufrechterhalten, nie aber für einen unbegrenzten Zeitraum; Leben, Tod.
Ähnlich trägt die menschliche Umwelt, das Gegenstück zu jedem menschlichen Leben, den Stempel eines funktionalen Musters; sie ist die komplementäre organische Form. Jedes Bauwerk, das daher die Illusion einer sozio-kulturellen Welt zu erschaffen vermag, einen „Ort“, an dem sich der Abdruck des menschlichen Lebens artikuliert, muss daher den Anschein des Organischen bei sich führen, einer lebendigen Form gleichen. Die Losung der Architektur lautet „Organisation“.
Liest man die Schriften großer Architekten mit philosophischen Neigungen – zum Beispiel von Louis Sullivan, seinem Schüler Frank Lloyd Wright oder von Le Corbusier – stößt man häufig auf Begriffe von organischem Wachstum, organischer Struktur, Leben, Natur, vitaler Funktion, vitalem Gefühl und auf unzählige andere Vorstellungen, die eher aus der Biologie als aus der Mechanik stammen. Keiner dieser Begriffe bezieht sich auf die realen Materialien oder den geographischen Raum, die ein Bauwerk benötigt. „Leben“, „Organismus“ und „Wachstum“ sind weder für ein Grundstück noch für Baustoffe von irgendeiner Bedeutung. Ihr Bezugspunkt ist der virtuelle Raum, das geschaffene Gebiet der menschlichen Beziehungen und Tätigkeiten. Der Ort, den ein Haus auf der Erde einnimmt – also seine Lokalisation im realen Raum -, bleibt derselbe, auch wenn das Haus abbrennt, zerfällt und abgerissen wird. Der vom Architekten erschaffene Ort ist hingegen eine Illusion, erzeugt durch den sichtbaren Ausdruck eines Gefühls, das, was wir manchmal „Atmosphäre“ nennen. Diese Art von Ort verschwindet mit der Zerstörung des Hauses oder verändert sich tiefgreifend, wenn das Haus irgendeinen einschneidenden Umbau erlebt. Der Umbau braucht nicht einmal sehr radikal oder umfangreich zu sein: Protzige Dachgauben, überladene Vordächer und andere Auswüchse sind nur die Spitze des Eisbergs. Eine scheußliche Farbgebung und eine zusammengewürfelte Inneneinrichtung sind ein vergleichsweise milder Fehlgriff, aber das könnte sehr wohl reichen, um die architektonische Illusion einer sozio-kulturellenTotalität oder den virtuellen „Ort“ zu zerstören. [Anm.]
[Anm.] Vieles ließe sich hier über die Innengestaltung sagen, d.h. über Möblierung und Dekoration. Bei diesem Thema ergeben sich jedoch interessante Beziehungen zum Problem der Aufführung, das sich in der Musik, im Schauspiel und Ballett stellt. Ich werde es daher bis zu einem späteren Kapitel verschieben.
Quelle Susanne K. Langer: Fühlen und Form / Eine Theorie der Kunst / Aus dem Amerikanischen übersetzt von Christiana Goldmann und Christian Grüny. / Wissenschaftliche Buchgesellschaft (Felix Meiner Verlag Hamburg 2018) ISBN 978-3-534-27034-7 (Zitat Seite 204 ff)
Der hier wiedergegebene Abschnitt überzeugt mich im Nachhinein weniger als der über ZEIT. Ich muss ihn später ergänzen. (Ja, die Seiten vorher fehlen eben…)
 Völs: Abendblick auf Schloss Prösels (JR)
Völs: Abendblick auf Schloss Prösels (JR)
Man könnte auch behaupten, all dies gelte heute nicht mehr, es entspreche dem Geist der Vormoderne, so wie auch das Wort von der „virtuellen“ Umwelt in diesem Zusammenhang. Dabei ist Hybris völlig unangebracht. Sie entspringt der berechtigten Angst, dass uns heute unversehens alle Felle der mühsam gegen die Natur erkämpften Hochkultur wegschwimmen, dass uns nicht einmal das Wunder der digitalen Welt erhalten bleibt, wenn alle Wälder verbrannt sind…
Zu „organischer Stadtbaukunst“ siehe hier und hier.
Die folgende Passage, die mit direktem Bezug auf das Raum-Konzept überdacht sein sollte, habe ich an anderer Stelle schon einmal zitiert und lese das Zitat im früheren Zusammenhang gern aufs neue, nämlich hier.
ZEIT
Die Elemente der Musik sind bewegte Klangformen, doch in ihrer Bewegung wird nichts fortbewegt. Das Reich, in dem sich tonale Einheiten bewegen, ist ein Reich der reinen Dauer. Diese Dauer ist allerdings so wenig wie die musikalischen Elemente ein reales Phänomen. Sie ist kein Zeitraum – nicht zehn Minuten, eine halbe Stunde oder irgendein Bruchteil eines Tages -, sondern etwas vollkommen anderes als die Zeit, in der sich unser öffentliches und praktisches Leben abspielt. Sie ist inkommensurabel mit dem Fortgang der Dinge des Alltags. Die musikalische Dauer ist ein Bild dessen, was man „gelebte“ oder „erfahrene“ Zeit nennen könnte – ein Bild des Lebensflusses, der für uns spürbar wird, wenn aus Erwartungen ein „Jetzt“ und das „Jetzt“ zu einer unabänderlichen Tatsache wird. Solch ein Fluss lässt sich nur in Bezug auf Empfindungen, Spannungen und Gefühle messen, und er weist nicht nur ein anderes Maß, sondern eine völlig andere Struktur auf als die wissenschaftliche Zeit oder jene, die unsere Alltagsgeschäfte bestimmt.
Der Schein dieser vitalen, erlebten Zeit ist die primäre Illusion der Musik. Die ganze Musik erschafft eine Ordnung der virtuellen Zeit, in der ihre tönenden Formen sich in Beziehung zueinander bewegen – immer und nur zueinander, denn etwas existiert dort nicht. Die virtuelle Zeit ist von der Aufeinanderfolge realer Geschehnisse so verschieden wie der virtuelle Raum vom realen. Zunächst einmal ist sei durch den Gebrauch eines einzigen Sinnes, des Gehörs, wahrnehmbar. Keine andere Art von sinnlicher Erfahrung tritt ergänzend hinzu. Schon allein dadurch unterscheidet sie sich erheblich von unserer „Common-Sense“-Version der Zeit, die sogar noch zusammengesetzter, heterogener und fragmentarischer als unser vergleichbarer Raumsinn ist. Innere Spannungen und äußere Veränderungen, Herzschläge und Uhren, Tageslicht, Routinen und Ermüdung liefern uns verschiedene unzusammenhängende Zeitinformationen, die wir aus praktischen Gründen dadurch koordinieren, dass wir die Herrschaft der Uhr akzeptieren. Die Musik hingegen bietet die Zeit unserem unmittelbaren, vollständigen Erfassen dar, indem sie es unserem Gehör erlaubt, sie zu monopolisieren – sie ganz allein zu organisieren, zu erfüllen und zu gestalten. Sie erschafft ein Bild der Zeit, wie sie gemessen wird durch die bewegten Formen, die ihr Substanz verleihen, eine Substanz freilich, die allein aus Klang besteht und so die Vergänglichkeit selbst ist. Musik macht Zeit hörbar und ihre Form und Kontinuität fühlbar.
Quelle Susanne K. Langer: Fühlen und Form a.a.O. Seite 220 f.