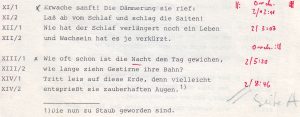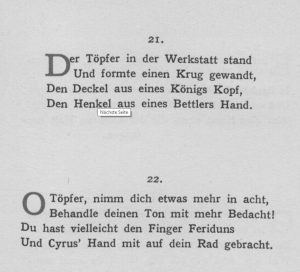Alte Geschichten
Humboldt und die Knochen des ausgerotteten Volkes, sowie: Heiliger Aquilin! Heute kommt die Reliquie aus Milano!
Ich kann gar nicht sagen, wie sehr es mich befremdet. Die Titelzeile zu lesen: „Eine Rippe geht auf Reisen nach Würzburg. / Eine Mailänder Delegation bringt den 1000 Jahre alten Knochen des heiligen Aquilin morgen in dessen Geburtsstadt. Dort wird er dann als Reliquie verwahrt.“ Dazu ein großes Buntfoto, das einem historischen Gemälde gleicht: „Offizielle des Erzbistums Mailand begutachten die mumifizierte Leiche des heiligen Aquilin, bevor ihm eine Rippe entnommen wird“.
Eine späte Operation gewissermaßen. Ich kann nicht anders als an die letzte Lektüre betreffend Knochenfunde am Orinoco zu denken, auch an den Streit um das Humboldt-Museum in Berlin, wo ein Freundeskreis der indianischen Völker vehement dagegen anging, die vielleicht hochverehrten Gebeine der Vorfahren als Schau-Objekte in einer Ausstellung ausgebreitet zu sehen. Ich malte mir aus, dass die Knochen von Stämmen zurückgefordert würden, deren Vorfahren selbst für die Ausrottung des Volkes verantwortlich waren, dessen Relikte nun dank Humboldt in Berlin liegen. Oder haben sie sich gewissermaßen posthum mit den Nachfahren „menschenfressender Kariben“ geeinigt? Siehe unten. Ich weiß zu wenig darüber, aber es gibt einiges zu lernen, wenn man sich über das Projekt im Internet kundig macht (die von mir verehrten Herren Parzinger und Bredekamp sind unmittelbar beteiligt: ein Stichwort ist Vanuatu – Südsee – wo man froh sei, dass in Europa Zeugnisse der Kolonialzeit aufbewahrt werden, von denen am Ort keine Spur mehr zu finden sei, da niemand eine Sorgfaltspflicht entwickelte). Als Ansatz für gründlicheres Studium siehe „Der Tagesspiegel“ 7.7.2015 hier.
Und nun Aquilin. Ich lese seine Legende – zugegeben mit wenig wohlwollenden Augen: hier. Was hat er zum Wohle der Menschheit geleistet? „Mit der erneuten Übergabe der bedeutenden Reliquie einer Rippe des Heiligen ehrt die Erzdiözese Mailand die Geburtsstadt Würzburg 1000 Jahre nach seinem Martyrium“, betont Dompfarrer Domkapitular Dr. Jürgen Vorndran. Biblisch gesehen stehe die Rippe symbolisch für die Erschaffung des menschlichen Lebens. So das Solinger Tageblatt (auch z.B. das Main-Echo berichtete). A propos „Erschaffung des menschlichen Lebens“: Ging es dabei nicht „nur“ um die Erschaffung Evas aus Adams Rippe? Gut, dankbar genug dürfen wir sein. Aber was war mit Aquilins Martyrium? O.k., er ist durch einen Dolchstoß ermordet worden. Aber dergleichen passiert doch immer wieder. Was ist am vorliegenden Fall bemerkenswert? (Siehe im zuletzt gegebenen Link, aus dem auch das folgende Zitat stammt):
Die Hauptstadt der Lombardei war in den Jahren vor 1018 Schauplatz heftiger politischer und religiöser Auseinandersetzungen. Arianer und Neumanichäer verbreiteten gnostisches Gedankengut und predigten – ganz im Gegensatz zur katholischen Kirche – eine totale Leibfeindlichkeit. Sie negierten die Trinitätslehre und bekämpften Kirche, Priestertum und Sakramente. Aquilin wandte sich voller Elan und Beredsamkeit gegen den Unglauben, Jesus sei nur Mensch, aber nicht Gott. Zwar bekehrte er auf diese Weise viele, machte sich aber zugleich auch erbitterte Feinde.
Ich frage mich, wer damals wirklich für Leibfeindlichkeit zuständig war und was sich hinter den Worten „voller Elan und Beredsamkeit“ verbirgt: wieviel Friedfertigkeit auf dieser und auf jener Seite? Was bedeutete eine Bekehrung? Den Leib ernstnehmen: kann das in anderen Zeiten auch bedeuten, einen Knochen oder die Mumifizierung einer Leiche maßlos zu überschätzen, ja, – vorsichtig gesagt – auch darüber hinauszugehen: in der Wahrheitsproduktion am lebenden Menschen sogar strenge körperliche Maßnahmen gutzuheißen?
In der Zeitung las ich auch, „dass mit Reliquien viel Schindluder getrieben wird wie mit T-Shirts von Michael Jackson. Es gibt Heilige, von denen gibt es 28 Beine, sagte der Kölner Kirchenexperte Manfred Becker-Huberti.“
Ich kann mir gut das listige, aufgeklärte Lächeln vorstellen, das diese Bemerkung begleitet haben mag. Es lässt mir keine Ruhe. Wie nun, wenn jemand fragte, was denn von Ascheresten zu halten sei, etwa Asche der Märtyrer, die auf Scheiterhaufen gestorben sind? Ist nicht gerade die Asche durch Bibelwort geheiligt? Ashes to ashes – gilt das nicht auch viceversa? Wo beginnt „magisches Denken“? Wo habe ich gelesen, dass wir alle aus Sternenstaub bestehen? Nicht metaphorisch, sondern real, in Fleisch und Knochen. Es war ein naturwissenschaftliches Werk, durchaus glaubwürdig, vielleicht populärer Ausrichtung, möglicherweise von Hoimar von Ditfurth. Ashes to ashes. Ich höre das in einer bestimmten aufsteigenden Tonfolge, aber nicht von David Bowie…
So, jetzt hab ich’s! Die Oysterband in einer WDR-Matinee der 80er Jahre, ohrenbetäubend: Ashes to ashes!!! Es rumort immer mal wieder in meinem Kopfe, seit damals. Ich werde es auf magischem Weg bannen, ein Link muss her. HIER (bitte erschrecken Sie nicht!).
Und die Sache mit dem Sternenstaub will ich auch noch in anderer Richtung überprüfen: Oum Kalthoum „Rubayat-el-Khayyam“. Er liegt unter unseren Füßen…während wir unsere Augen zum nächtlichen Sternenhimmel erheben.
Doch zunächst Alexander von Humboldt:
ZITAT (Quelle am Ende des Textes)
Der hintere Teil des Felstals ist mit dichtem Laubholze bedeckt. An diesem schattigen Orte öffnet sich die Höhle von Ataruipe: eigentlich nicht eine Höhle, sondern ein Gewölbe, eine weit überhangende Klippe, eine Bucht, welche die Wasser, als sie einst diese Höhe erreichten, ausgewaschen haben. Dieser Ort ist die Gruft eines vertilgten Völkerstammes. Wir zählten ungefähr 600 wohlerhaltene Skelette, in ebenso vielen Körben, die von den Stielen des Palmenlaubes geflochten sind. Diese Körbe, welche die Indianer Mapires nennen, bilden eine Art viereckiger Säcke, die nach dem Alter des Verstorbenen von verschiedener Größe sind. Selbst neugeborene Kinder haben ihr eigenes Mapire. Die Skelette sind so vollständig, daß keine Rippe, keine Phalange fehlt.
Die Knochen sind auf dreierlei Weise zubereitet: teils gebleicht, teils mit Onoto, dem Pigment der Bixa Orellana, rot gefärbt, teils mumienartig zwischen wohlriechendem Harze in Pisangblätter eingeknetet. Die Indianer versichern, man grabe den frischen Leichnam auf einige Monate in feuchte Erde, welche das Muskelfleisch allmählich verzehre; dann scharre man ihn aus und schabe mit scharfen Steinen den Rest des Fleisches von den Knochen ab. Dies sei noch der Gebrauch mancher Horden in der Guyana. Neben den Mapires oder Körben findet man auch Urnen von halbgebranntem Tone, welche die Knochen von ganzen Familien zu enthalten scheinen.
Die größeren dieser Urnen sind 3 Fuß hoch und 5½ Fuß lang, von angenehmer ovaler Form, grünlich, mit Henkeln in Gestalt von Krokodilen und Schlangen, an dem oberen Rande mit Mäandern und Labyrinthen geschmückt. Diese Verzierungen sind ganz denen ähnlich, welche die Wände des mexikanischen Palastes bei Mitla bedecken. Man findet sie unter allen Zonen, auf den verschiedensten Stufen menschlicher Kultur: unter Griechen und Römern, wie auf den Schildern der Otaheiter und anderer Inselbewohner der Südsee, überall, wo rhythmische Wiederholung regelmäßiger Formen dem Auge schmeichelt. Die Ursachen dieser Ähnlichkeiten beruhen, wie ich an einem andern Orte entwickelt habe, mehr auf psychischen Gründen, auf der innern Natur unserer Geistesanlagen, als daß sie Gleichheit der Abstammung und alten Verkehr der Völker beweisen.
Unsere Dolmetscher konnten keine sichere Auskunft über das Alter dieser Gefäße geben. Die mehrsten Skelette schienen indes nicht über hundert Jahre alt zu sein. Es geht die Sage unter den Guareca-Indianern, die tapferen Aturer haben sich, von menschenfressenden Kariben bedrängt, auf die Klippen der Katarakten gerettet; ein trauriger Wohnsitz, in welchem der bedrängte Völkerstamm und mit ihm seine Sprache unterging. In dem unzugänglichsten Teile des Raudals befinden sich ähnliche Grüfte; ja es ist wahrscheinlich, daß die letzte Familie der Aturer spät erst ausgestorben sei. Denn in Maipures (ein sonderbares Faktum) lebt noch ein alter Papagei, von dem die Eingeborenen behaupten, daß man ihn darum nicht verstehe, weil er die Sprache der Aturer rede.
Wir verließen die Höhle bei einbrechender Nacht, nachdem wir mehrere Schädel und das vollständige Skelett eines bejahrten Mannes, zum größten Ärgernis unsrer indianischen Führer, gesammelt hatten. Einer dieser Schädel ist von Blumenbach in seinem vortrefflichen kraniologischen Werke abgebildet worden. Das Skelett selbst aber ging, wie ein großer Teil unsrer Naturaliensammlungen, besonders der entomologischen, in einem Schiffbruch verloren, welcher an der afrikanischen Küste unserem Freunde und ehemaligen Reisegefährten, dem jungen Franziskanermönche Juan Gonzalez, das Leben kostete.
Wie im Vorgefühl dieses schmerzhaften Verlustes, in ernster Stimmung, entfernten wir uns von der Gruft eines untergegangenen Völkerstammes. Es war eine der heiteren und kühlen Nächte, die unter den Wendekreisen so gewöhnlich sind. Mit farbigen Ringen umgeben, stand die Mondscheibe hoch im Zenit. Sie erleuchtete den Saum des Nebels, welcher in scharfen Umrissen, wolkenartig, den schäumenden Fluß bedeckte. Zahllose Insekten gossen ihr rötliches Phosphorlicht über die krautbedeckte Erde. Von dem lebendigen Feuer erglühte der Boden, als habe die sternenvolle Himmelsdecke sich auf die Grasflur niedergesenkt. Rankende Bignonien, duftende Vanille und gelbblühende Banisterien schmückten den Eingang der Höhle. Über dem Grabe rauschten die Gipfel der Palmen.
So sterben dahin die Geschlechter der Menschen. Es verhallt die rühmliche Kunde der Völker. Doch wenn jede Blüte des Geistes welkt, wenn im Sturm der Zeiten die Werke schaffender Kunst zerstieben, so entsprießt ewig neues Leben aus dem Schoße der Erde. Rastlos entfaltet ihre Knospen die zeugende Natur: unbekümmert, ob der frevelnde Mensch (ein nie versöhntes Geschlecht) die reifende Frucht zertritt.
Quelle Alexander von Humboldt: Ansichten der Natur / Seinem teuren Bruder Wilhelm von Humboldt in Rom / Berlin, im Mai 1807 / Philipp Reclam jun. Stuttgart 1999 ISBN 3-15-002948
Abrufbar hier: http://gutenberg.spiegel.de/buch/ansichten-der-natur-4756/9
Nachtrag I
Die Augen und der Staub unter unseren Füßen
Was für eine wunderbare Gedankenkonstellation! Die Gestirne, die dort oben ihre Bahn ziehen, und unter uns die zauberhaften Augen, die zu Staub geworden sind. Die roten Zahlen beziehen sich auf die CD mit der Aufnahme von Oum Kalthoums „Rubayat-al-Khayyam“, Übersetzung Gabriele Braune.
Durch „Zufall“ bin ich inzwischen auf die Gedichte Al-Khayyams (alias Omar der Zeltmacher) gestoßen, von denen also Ahmed Rami, der Textdichter Oum Kalthoums, ausgegangen ist, viel direkter, als ich bisher geglaubt hatte.
Gefunden hier / Aber: ich muss in meinen eigenen Ausgaben nach dem Übersetzer fahnden (Rückert?). Fehlanzeige bei Stefanie Gsell, bei Jala Rostami und Ludwig Verbeek, und dann endlich Rosen (marix verlag), Rosen (Insel-Bücherei).
Es ist Friedrich Rosen! Das Digilisat der Originalausgabe fand ich hier. Ein Beispiel daraus als Screenshot:
Und als Zugabe eine Nachdichtung von Hans Bethge 1921 (Yin Yang Media Verlag Kelkheim 2001 Seite 66):
DER TÖNERNE KRUG
Du, Krug aus Ton, warst einstmals ein Verliebter
Wie ich. Du hast geseufzt in Liebesnächten
Nach deiner Freundin aufgelösten Flechten.
Um eines Mädchens Nacken, hold und warm,
Lagst du, o Henkel, zärtlich einst als Arm.
NACHTRAG II (5.2.17)
ZITAT
Die moderne Kosmologie hat dem Menschen eine seiner großen narzisstischen Kränkungen zugefügt. Der Homo sapiens befindet sich nicht im Zentrum der Schöpfung, sondern rast auf einem unbedeutenden Planeten in einem Sonnensystem unter unendlich vielen anderen durch einen Weltenraum ohne Sinn und Verstand. Schrotts Epos kommentiert dies kühl: „sonnenstaub also sind wir – aus stoff, der in sternen entstand“. Das dergestalt pulverisierte „Ich“ mag sich als Seele auffassen, mag mit Stolz auf seine zivilisatorischen Leistungen oder seine Arbeit blicken, eigentlich aber lässt er sich auf einen Rohstoffwert von etwa 40 Cent reduzieren: „mein körper die zwei kilo asche die von mir übrig bleiben: vom kohlenstoff über spuren von blei und gold bis zum radium“. Für das Leben auf der Erde wäre es ohnehin besser gewesen, wenn der Mensch das Sonnenstaubstadium nie verlassen hätte. Die Natur bracht uns nicht. Für ihr Gefüge sind ganz andere Tiere von Bedeutung. Ohne Mensch würde die Artenvielfalt schlagartig ansteigen; ohne Insekten wären die komplette Fauna und Flora unseres Blauen Planeten schon nach 50 Jahren erledigt.
Quelle DIE ZEIT 2. Februar 2017 Seite 39 Wir stehen alle im selben Wind Raoul Schrott hat ein Epos von der Entsehung des Universums gedichtet – streng auf der Grundlage der Naturwissenschaften. Von Steffen Martus.
Nachtrag III (11.2.2017)
Man kann es sich nicht deutlich genug machen: die große Wende um das Jahr 1000 (siehe zu Anfang dieses Artikels) bedeutete den Anfang unserer Zivilisation. Es war
für die Völker des abendländischen Europas die Zeit eines allmählichen Aufstiegs aus der Barbarei. Damals befreiten sie sich von den Hungersnöten, sie traten eines nach dem anderen in die Geschichte ein und begaben sich auf den Weg eines kontinuierlichen Fortschritts. Erwachen, Kindheit. In der Tat fiel besagter Teil der Welt seit eben diesem Zeitpunkt keinen Invasionen mehr zum Opfer – und das sollte hinfort sein einzigartiger Vorteil gegenüber allen anderen Regionen sowie die Bedingung seines fortschreitenden Aufstiegs sein. Jahrhundertelang hatte sich die rastlose Unruhe der wandernden Völker fast pausenlos über das Abendland ergossen; jahrhundertelang harre sie die Ordnung der Dinge immer wieder aus den Fugen gebracht, zerschlagen, beschädigt und zerstört. Zwar war es den karolingischen Eroberungen vorübergehend geklungen, einen Anschein von Disziplin und Frieden im kontinentalen Europa wiederherzustellen; doch kaum war Karl der Große verschwunden, näherten sich von allen Seiten, von Skandinavien, den Steppen des Ostens und den inzwischen vom Islam beherrschten Mittelmeerinseln wieder unbezwingbare Banden und stürzten sich auf die römische Christenheit, um sie zu plündern. Die allerersten Keime dessen, was wir als romanischen Kunst bezeichnen, lassen sich genau in dem Moment erkennen, in dem diese Einfälle aufhören, in dem die Normannen seßhaft und gesellig werden, der ungarische König sich bekehrt und der Graf von Arles die sarazenischen Piraten, die die Alpenpässe in der Hand und den Abt von Cluny gerade noch um ein Lösegeld erpreßt hatten, aus ihren Schlupfwinkeln vertreibt. nach 980 sieht man keine ausgeraubten Abteien mehr, und die Scharen aufgeschreckter Mönche, die sich mitsamt ihren Reliquien und Schätzen auf die Flucht gemacht hatten, verschwinden von den Wegen. Wenn hinfort Brandschaden am Horizont der Wälder aufsteigen, sind es Zeichen der Rodung und nicht mehr der Plünderung. (…)
[Die] Unterschiede waren nirgends so scharf ausgeprägt wie an den Grenzen der lateinischen Welt. Gegen Norden, Westen und Osten zog sich im weiten Halbkreis eine vergleichsweise dichte Zone der Barbarei um die christlichen Länder, in der das Heidentum fortlebte. Dort hatte sich vor nicht allzu langer Zeit die skandinavische Expansion entwickelt, die der dänischen und norwegischen Seefahrer und der gotländischen Händler, aus der sich dauerhafte, über die Flußmündungen stromaufwärts führende Schiffsverbindungen ergeben hatten. Dieser ganze Raum wurde immer noch häufig durch überfallartige Verwüstungen verunsichert, doch allmählich beruhigten sich die Rivalen unter den Stämmen und wichen dem friedlichen Handel. Von weit her kamen Missionare, von den sächsischen Zufluchtsstätten in England, den Ufern der Elbe, aus den thüringischen und böhmischen Wäldern und aus Niederösterreich, um die letzten Idole zu zerstören, das Kreuz zu errichten. Viele von ihnen endeten als Märtyrer. Doch die Fürsten dieser Gegenden, in denen die Völker sich nun langsam niederließen, Dörfer bauten und Gebietsabgrenzungen schufen, waren schon eher bereit, ihre Untertanen zur Taufe zu bringen; sie hießen mit dem Evangelium ein wenig Zivilisation willkommen. In deutlichem Gegensatz zu diesen noch sehr rohen Randgebieten standen die südlichen Marken, die Marken Italiens und die der iberischen Halbinsel. Hier erfolgt die Begegnung mit dem Islam, mit der byzantinischen Christenheit, das heißt mit sehr viel zivilisierteren Welten.
Quelle Georges Duby: Die Zeit der Kathedralen / Kunst und Gesellschaft 980-1420 /Übersetzt von Grete Osterwald / suhrkamp taschenbuch wissenschaft / Frankfurt am Main 1980, 1992 (Gallimard 1976). Zitat Seite 17 und 18.