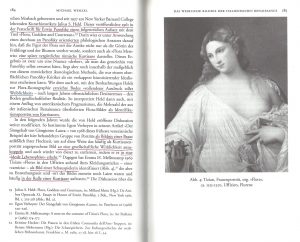Komponenten der Schönheit
Bevor wir Schillers philosophische Schriften gründlich zu lesen anfangen, sollte uns klar sein, in welchem Maße unsere Klassiker vom Geist des Griechentums besessen waren. Was immer sie darunter verstanden, – keine Skepsis kann uns darüber hinweghelfen, dass wir allzu wenig darüber wissen und doch glauben, uns davon distanzieren zu können. Kein Wort mehr in dieser Richtung. Wollen wir etwa die Weisheit des Genderismus dagegensetzen, wenn uns jemand mit den Grazien kommt, oder sein Schönheitsideal aus den Proportionen der Venus ableiten will? Halten wir doch erstmal inne, sobald wir wissen, dass uns einiges an notwendigem Wissen fehlt, wenn Friedrich Schiller also anhebt:
Die griechische Fabel legt der Göttin der Schönheit einen Gürtel bei, der die Kraft besitzt, Dem, der ihn trägt, Anmuth zu verleihen und Liebe zu erwerben. Eben diese Gottheit wird von den Huldgöttinnen oder den Grazien begleitet.
Die Griechen unterschieden also die Anmuth und die Grazien noch von der Schönheit, da sie solche durch Attribute ausdrückten, die von der Schönheitsgöttin zu trennen waren. Alle Anmuth ist schön, denn der Gürtel des Liebreizes ist ein Eigenthum der Göttin von Cnidus; aber nicht alles Schöne ist Anmuth, denn auch ohne diesen Gürtel bleibt Venus, was sie ist.
Nach eben dieser Allegorie ist es die Schönheitsgöttin allein, die den Gürtel des Reizes trägt und verleiht. Juno, die herrliche Königin des Himmels, muß jenen Gürtel erst von der Venus entlehnen, wenn sie den Jupiter auf dem Ida bezaubern will. Hoheit also, selbst wenn ein gewisser Grad von Schönheit sie schmückt (den man der Gattin Jupiters keineswegs abspricht), ist ohne Anmuth nicht sicher, zu gefallen; denn nicht von ihren eigenen Reizen, sondern von dem Gürtel der Venus erwartet die hohe Götterkönigin den Sieg über Jupiters Herz.
Was ist mit dem Gürtel? Wer genau ist die Göttin von Cnidus? Hier ist der erste Schritt zum Verständnis. Hätte jemand geahnt, dass die griechische Nackheit durchaus nicht so selbstverständlich war, wie seit den Jahren der Wiederentdeckung vorausgesetzt wurde? Wiedergeburt, Renaissance. Dass die Scham, zumindest die weibliche, ein Thema war? Nichts falscher als an die Kriterien einer FKK-„Kultur“ zu denken. (Siehe am Ende des Artikels zum David hier). Wohlgemerkt, bei Wikipedia heißt es:
Der Bildhauer habe dann zwei Versionen angefertigt: eine vollständig bekleidete und eine völlig nackte. Die schockierten Einwohner von Kos hätten die Nackte zurückgewiesen und die bekleidete Version gewählt.
Von der letzteren ist keine Kopie überliefert. Nimmt uns das wunder?
Der Gürtel! Verstehen Sie, was er bedeutet? Siehe dazu hier. (Nebenbei auch hier.) Was also ist der Unterschied zwischen Schönheit und „Anmuth“? Hat Anmut immer mit Bewegung zu tun? (Ist es unanständig, in diesem Zusammenhang an Sex appeal zu denken? Man schaue nur auf das Knäblein an der Seite der weiblichen Figur, eine Priapus-Gestalt, die jedoch – wie die ganze Skulptur – aus römischer Zeit stammt. Man mag sie nicht geil nennen.)
Weiter mit Schiller:
Die Schönheitsgöttin kann aber doch ihren Gürtel entäußern und seine Kraft auf das Minderschöne übertragen. Anmuth ist also kein ausschließendes Prärogativ des Schönen, sondern kann auch, obgleich immer nur aus der Hand des Schönen, auf das Minderschöne, ja selbst auf das Nichtschöne übergehen.
Die nämlichen Griechen empfahlen Demjenigen, dem bei allen übrigen Geistesvorzügen die Anmuth, das Gefällige fehlte, den Grazien zu opfern. Diese Göttinnen wurden also von ihnen zwar als Begleiterinnen des schönen Geschlechts vorgestellt, aber doch als solche, die auch dem Mann gewogen werden können und die ihm, wenn er gefallen will, unentbehrlich sind.
Was ist aber nun die Anmuth, wenn sie sich mit dem Schönen zwar am liebsten, aber doch nicht ausschließend verbindet? wenn sie zwar von dem Schönen herstammt, aber die Wirkungen desselben auch an dem Nichtschönen offenbart? wenn die Schönheit zwar ohne sie bestehen, aber durch sie allein Neigung einflößen kann?
Das zarte Gefühl der Griechen unterschied frühe schon, was die Vernunft noch nicht zu verdeutlichen fähig war, und nach einem Ausdruck strebend, erborgte es von der Einbildungskraft Bilder, da ihm der Verstand noch keine Begriffe darbieten konnte. Jener Mythus ist daher der Achtung des Philosophen werth, der sich ohnehin damit begnügen muß, zu den Anschauungen, in welchen der reine Natursinn seine Entdeckungen niederlegt, die Begriffe aufzusuchen, oder mit andern Worten, die Bilderschrift der Empfindungen zu erklären.
Entkleidet man die Vorstellung der Griechen von ihrer allegorischen Hülle, so scheint sie keinen andern als folgenden Sinn einschließen.
Bemerkenswert übrigens, dass Schiller auch von „Demjenigen“ spricht, und dass die Grazien auch dem Manne gewogen sein sollten, ja unentbehrlich sind, wenn er gefallen will.
Anmuth ist eine bewegliche Schönheit; eine Schönheit nämlich, die an ihrem Subjekte zufällig entstehen und eben so aufhören kann. Dadurch unterscheidet sie sich von der fixen Schönheit, die mit dem Subjekte selbst nothwendig gegeben ist. Ihren Gürtel kann Venus abnehmen und der Juno augenblicklich überlassen; ihre Schönheit würde sie nur mit ihrer Person weggeben können. Ohne ihren Gürtel ist sie nicht mehr die reizende Venus, ohne Schönheit ist sie nicht Venus mehr.
Dieser Gürtel, als das Symbol der beweglichen Schönheit, hat aber das ganz Besondere, daß er der Person, die damit geschmückt wird, die objektive Eigenschaft der Anmuth verleiht; und unterscheidet sich dadurch von jedem andern Schmuck, der nicht die Person selbst, sondern bloß den Eindruck derselben, subjektiv, in der Vorstellung eines Andern, verändert. Es ist der ausdrückliche Sinn des griechischen Mythus, daß sich die Anmuth in eine Eigenschaft der Person verwandle, und daß die Trägerin des Gürtels wirklich liebenswürdig sei, nicht bloß so scheine.
Ein Gürtel, der nicht mehr ist als ein zufälliger äußerlicher Schmuck, scheint allerdings kein ganz passendes Bild zu sein, die persönliche Eigenschaft der Anmuth zu bezeichnen; aber eine persönliche Eigenschaft, die zugleich als zertrennbar von dem Subjekte gedacht wird, konnte nicht wohl anders, als durch eine zufällige Zierde versinnlicht werden, die sich unbeschadet der Person von ihr trennen läßt.
Der Gürtel des Reizes wirkt also nicht natürlich, weil er in diesem Fall an der Person selbst nichts verändern könnte, sondern er wirkt magisch, das ist, seine Kraft wird über alle Naturbedingungen erweitert. Durch diese Auskunft (die freilich nicht mehr ist als ein Behelf) sollte der Widerspruch gehoben werden, in den das Darstellungsvermögen sich jederzeit unvermeidlich verwickelt, wenn es für das, was außerhalb der Natur im Reiche der Freiheit liegt, in der Natur einen Ausdruck sucht.
Wenn nun der Gürtel des Reizes eine objektive Eigenschaft aufdrückt, die sich von ihrem Subjekte absondern läßt, ohne deßwegen etwas an der Natur desselben zu verändern, so kann er nichts anders als Schönheit der Bewegung bezeichnen; denn Bewegung ist die einzige Veränderung, die mit einem Gegenstand vorgehen kann, ohne seine Identität aufzuheben.
Schönheit der Bewegung ist ein Begriff, der beiden Forderungen Genüge leistet, die in dem angeführten Mythus enthalten sind. Sie ist erstlich objektiv und kommt dem Gegenstande selbst zu, nicht bloß der Art, wie wir ihn aufnehmen. Sie ist zweitens etwas Zufälliges an demselben, und der Gegenstand bleibt übrig, auch wenn wir diese Eigenschaft von ihm wegdenken.
Der Gürtel des Reizes verliert auch bei dem Minderschönen und selbst bei dem Nichtschönen seine magische Kraft nicht; das heißt, auch das Minderschöne, auch das Nichtschöne kann sich schön bewegen.
Die Anmuth, sagt der Mythus, ist etwas Zufälliges an ihrem Subjekt; daher können nur zufällige Bewegungen diese Eigenschaft haben. An einem Ideal der Schönheit müssen alle nothwendigen Bewegungen schön sein, weil sie, als nothwendig, zu seiner Natur gehören; die Schönheit dieser Bewegungen ist also schon mit dem Begriff der Venus gegeben; die Schönheit der zufälligen ist hingegen eine Erweiterung dieses Begriffs. Es gibt eine Anmuth der Stimme, aber keine Anmuth des Athemholens.
Ist aber jede Schönheit der zufälligen Bewegungen Anmuth?
Eine andere Zwischenfrage, die noch nicht im Text anklang: Was ist eigentlich Moral?
Wir verstehen darunter oft – sehr vereinfacht – ein menschenfreundliches Wertesystem, gern auch (einfach) ein christliches. Und wenn Nietzsche Schiller als „Moraltrompeter von Säckingen“ bezeichnet, hat er sich offenbar dieses Vorurteils bedient. Obwohl gerade er wusste, was alles ins Gebiet der Moral fällt, eben auch die von ihm präferierte „Herrenmoral“. Im philosophischen Sinne halten wir uns an das Metzler-Lexikon: demnach bezeichnet Moral
den Inbegriff moralischer Normen, Werturteile und Institutionen. Moral beschreibt ein vorhandenes Verhalten in einer Gemeinschaft und umfasst alle Ordnungs- und Sinngebilde, die durch Tradition oder Konvention vermittelt werden. In Form eines Katalogs materialer Norm- und Wertvorstellungen regelt sie die Bedürfnisbefriedigung einer menschlichen Gemeinschaft und bestimmt deren Pflichten. Moralen differieren in Bezug auf den Inhalt ihrer Normen von Kultur zu Kultur. Sie unterliegen geschichtlichen Veränderungsprozessen und wandeln sich entsprechend den veränderten menschlichen Selbstverständnissen. Der Sollensanspruch der Moral ist unabhängig von dem veränderlichen Inhalt der Normen und Gebote. D.h. für jede Moral ist ein Anspruch auf allgemeine Verbindlichkeit konstitutiv.
Ich füge diese (unvollständige) Definition an dieser Stelle nur ein, um daran zu erinnern, dass man Schillers Begrifflichkeit nicht allzu intuitiv auffassen sollte, sie bezieht sich ja unmittelbar auf KANT; wobei aber nun die leichtere Lesbarkeit nicht ohne Tücken ist. Verstehen wir nicht zu schnell! Folgen wir Schiller in bedächtiger Leseweise. Ich wechsele auch regelmäßig zu anderen Schriftbildern (Dünndruckausgabe der 50er Jahre) oder in die Wiedergabe des Projekts Gutenberg . Und folge Schiller weiter in seiner Antwort auf die zuletzt gestellte Frage:
Ist aber jede Schönheit der zufälligen Bewegungen Anmuth?
Daß der griechische Mythus Anmuth und Grazie nur auf die Menschheit einschränke, wird kaum einer Erinnerung bedürfen; er geht sogar noch weiter und schließt selbst die Schönheit der Gestalt in die Grenzen der Menschengattung ein, unter welcher der Grieche bekanntlich auch seine Götter begreift. Ist aber die Anmuth nur ein Vorrecht der Menschenbildung, so kann keine derjenigen Bewegungen darauf Anspruch machen, die der Mensch auch mit dem, was bloß Natur ist, gemein hat. Könnten also die Locken an einem schönen Haupte sich mit Anmuth bewegen, so wäre kein Grund mehr vorhanden, warum nicht auch die Aeste eines Baumes, die Wellen eines Stroms, die Saaten eines Kornfelds, die Gliedmaßen der Thiere sich mit Anmuth bewegen sollten. Aber die Göttin von Cnidus repräsentiert nur die menschliche Gattung, und da, wo der Mensch weiter nichts als ein Naturding und Sinnenwesen ist, da hört sie auf, für ihn Bedeutung zu haben.
Willkürlichen Bewegungen allein kann also Anmuth zukommen, aber auch unter diesen nur denjenigen, die ein Ausdruck moralischer Empfindungen sind. Bewegungen, welche keine andere Quelle als die Sinnlichkeit haben, gehören bei aller Willkürlichkeit doch nur der Natur an, die für sich allein sich nie bis zur Anmuth erhebt. Könnte sich die Begierde mit Anmuth, der Instinkt mit Grazie äußern, so würden Anmuth und Grazie nicht mehr fähig und würdig sein, der Menschheit zu einem Ausdruck zu dienen.
Und doch ist es die Menschheit allein, in die der Grieche alle Schönheit und Vollkommenheit einschließt. Nie darf sich ihm die Sinnlichkeit ohne Seele zeigen, und seinem humanen Gefühl ist es gleich unmöglich, die rohe Thierheit und die Intelligenz zu vereinzeln. Wie er jeder Idee sogleich einen Leib anbildet und auch das Geistigste zu verkörpern strebt, so fordert er von jeder Handlung des Instinkts an dem Menschen zugleich einen Ausdruck seiner sittlichen Bestimmung. Dem Griechen ist die Natur nie bloß Natur: darum darf er auch nicht erröthen, sie zu ehren; ihm ist die Vernunft niemals bloß Vernunft: darum darf er auch nicht zittern, unter ihren Maßstab zu treten. Natur und Sittlichkeit, Materie und Geist, Erde und Himmel fließen wunderbar schön in seinen Dichtungen zusammen. Er führte die Freiheit, die nur im Olympus zu Hause ist, auch in die Geschäfte der Sinnlichkeit ein, und dafür wird man es ihm hingehen lassen, daß er die Sinnlichkeit in den Olympus versetzte.
Dieser zärtliche Sinn der Griechen nun, der das Materielle immer nur unter der Begleitung des Geistigen duldet, weiß von keiner willkürlichen Bewegung am Menschen, die nur der Sinnlichkeit allein angehörte, ohne zugleich ein Ausdruck des moralisch empfindenden Geistes zu sein. Daher ist ihm auch die Anmuth nichts anders, als ein solcher schöner Ausdruck der Seele in den willkürlichen Bewegungen. Wo also Anmuth stattfindet, da ist die Seele das bewegende Princip, und in ihr ist der Grund von der Schönheit der Bewegung enthalten. Und so löst sich denn jene mythische Vorstellung in folgenden Gedanken auf: »Anmuth ist eine Schönheit, die nicht von der Natur gegeben, sondern von dem Subjekte selbst hervorgebracht wird.«
Ich habe mich bis jetzt darauf eingeschränkt, den Begriff der Anmuth aus der griechischen Fabel zu entwickeln und, wie ich hoffe, ohne ihr Gewalt anzuthun. Jetzt sei mir erlaubt, zu versuchen, was sich auf dem Weg der philosophischen Untersuchung darüber ausmachen läßt, und ob es auch hier, wie in so viel andern Fällen, wahr ist, daß sich die philosophierende Vernunft weniger Entdeckungen rühmen kann, die der Sinn nicht schon dunkel geahnet und die Poesie nicht geoffenbart hätte.
Bevor Schiller nun einen neuen Begriff einführt, den der architektonischen Schönheit – wohlgemerkt: des Menschen –
Mit diesem Namen will ich denjenigen Teil der menschlichen Schönheit bezeichnet haben, der nicht bloß durch Naturkräfte ausgeführt worden (was von jeder Erscheinung gilt), sondern der auch nur allein durch Naturkräfte bestimmt ist.
möchte ich mich einschalten, um jenseits aller modernen Wokeness-Bedenken ein paar Beobachtungen zu verbalisieren, die sich aus alten Gewohnheiten heraus nicht eliminieren lassen. Man registriert andere Menschen nicht, ohne insgeheim ihr Aussehen zu bewerten (oder auch zu relativieren). In welche Runde man auch immer gelangt, – ob real oder als Fernsehzuschauer/in – man weiß, wer gut aussieht, oder bei wem man, sagen wir, von einer instinktiven Bewertung absieht, oder auch abstreitet, dass dies überhaupt eine Rolle spielt. Immer wieder kommt man aber zu der Erfahrung, dass jemand im Laufe eines Gespräches auf geheimnisvolle Weise sein/ihr Aussehen ändert. Klartext: wer hässlich wirkte, erscheint plötzlich ausdrucksvoll, um nicht zu sagen „schön“. Die Gesprächsbeiträge haben den naturgegebenen Ausdruck des Gesichtes überlagert. Ich kann natürlich grundsätzlich jede Äußerung über „gutes Aussehen“ oder gar „Schönheit“ unterlassen oder zurückweisen, was aber nicht garantiert, dass die Einschätzungen im Untergrund nicht um so heftiger ihr Unwesen treiben. Eine Frau, die noch keinen Ton gesagt hat, kann mir die Kehle zuschnüren. Angesichts eines (jungen) Mannes neutralisiert man sich gern mit Spott (und der Melodie: „Du hast die Haare schön, du hast die Haare schön!“).
Ganz verpönt ist der Ausdruck von der „schönen Seele“ (anders noch als: „Gutmensch“), er wirkt ebenfalls sofort ironisch, und wenn er bei Schiller auftaucht, muss man ihn fortwährend „passend“ paraphrasieren.
Ich bin allerdings glücklich über Schillers Begriff von der architektonischen Schönheit des Menschen. Und würde ihn auch anstandslos auf das Tier übertragen, auf ein edles Pferd, natürlich auch auf einen Schmetterling, sogar auf eine Raupe oder eine Kröte; bei deren Charakterisierung wir vielleicht das Wort Anmut vermeiden würden, außer bei übertrieben poetisierender Tendenz. Bei Gelegenheit schaue ich nochmal in das Buch von Josef H. Reichholt (der wohl immer schon gut aussah).
 s.a. hier (u.a.Bredekamp)
s.a. hier (u.a.Bredekamp)
Was ist es nun, das sich verändert, wenn ein Mensch nach einem Gespräch anders aussieht als vorher?
Wir folgen Schiller:
Venus, ohne ihren Gürtel und ohne die Grazien, repräsentiert uns das Ideal der Schönheit, so wie letztere aus den Händen der bloßen Natur kommen kann und, ohne die Einwirkung eines empfindenden Geistes, durch die plastischen Kräfte erzeugt wird. Mit Recht stellt die Fabel für diese Schönheit eine eigene Göttergestalt zur Repräsentantin auf, denn schon das natürliche Gefühl unterscheidet sie auf das strengste von derjenigen, die dem Einfluß eines empfindenden Geistes ihren Ursprung verdankt.
Es sei mir erlaubt, diese von der bloßen Natur, nach dem Gesetz der Nothwendigkeit gebildete Schönheit, zum Unterschied von der, welche sich nach Freiheitsbedingungen richtet, die Schönheit des Baues ( architektonische Schönheit) zu benennen. Mit diesem Namen will ich also denjenigen Theil der menschlichen Schönheit bezeichnet haben, der nicht bloß durch Naturkräfte ausgeführt worden (was von jeder Erscheinung gilt), sondernder auch nur allein durch Naturkräfte bestimmt ist.
Ein glückliches Verhältniß der Glieder, fließende Umrisse, ein lieblicher Teint, eine zarte Haut, ein feiner und freier Wuchs, eine wohlklingende Stimme u. s. f. sind Vorzüge, die man bloß der Natur und dem Glück zu verdanken hat; der Natur, welche die Anlage dazu hergab und selbst entwickelte; dem Glück, welches das Bildungsgeschäft der Natur vor jeder Einwirkung feindlicher Kräfte beschützte.
Diese Venus steigt schon ganz vollendet aus dem Schaume des Meers empor: vollendet, denn sie ist ein beschlossenes, streng abgewogenes Werk der Nothwendigkeit, und als solches keiner Varietät, keiner Erweiterung fähig. Da sie nämlich nichts anders ist, als ein schöner Vortrag der Zwecke, welche die Natur mit dem Menschen beabsichtet, und daher jede ihrer Eigenschaften durch den Begriff, der ihr zum Grunde liegt, vollkommen entschieden ist, so kann sie – der Anlage nach – als ganz gegeben beurtheilt werden, obgleich diese erst unter Zeitbedingungen zur Entwicklung kommt.
Die architektonische Schönheit der menschlichen Bildung muß von der technischen Vollkommenheit derselben wohl unterschieden werden. Unter der letztern hat man das System der Zwecke selbst zu verstehen, so wie sie sich untereinander zu einem obersten Endzweck vereinigen; unter der erstern hingegen bloß eine Eigenschaft der Darstellung dieser Zwecke, so wie sie sich dem anschauenden Vermögen in der Erscheinung offenbaren. Wenn man also von der Schönheit spricht, so wird weder der materielle Werth dieser Zwecke, noch die formale Kunstmäßigkeit ihrer Verbindung dabei in Betrachtung gezogen. Das anschauende Vermögen hält sich einzig nur an die Art des Erscheinens, ohne auf die logische Beschaffenheit seines Objektes die geringste Rücksicht zu nehmen. Ob also gleich die architektonische Schönheit des menschlichen Baues [← Achtung: im Gutenberg-Text steht an dieser Stelle sinnloserweise das Wort „Balles“] durch den Begriff, der demselben zum Grunde liegt, und durch die Zwecke bedingt ist, welche die Natur mit ihm beabsichtet, so isoliert doch das ästhetische Urtheil sie völlig von diesen Zwecken, und nichts, als was der Erscheinung unmittelbar und eigentümlich angehört, wird in die Vorstellung der Schönheit aufgenommen.
Man kann daher auch nicht sagen, daß die Würde der Menschheit die Schönheit des menschlichen Baues erhöhe. In unser Urtheil über die letztere kann die Vorstellung der erstern zwar einfließen, aber alsdann hört es zugleich auf, ein rein ästhetisches Urtheil zu sein. Die Technik der menschlichen Gestalt ist allerdings ein Ausdruck seiner Bestimmung, und als ein solcher darf und soll sie uns mit Achtung erfüllen. Aber diese Technik wird nicht dem Sinn, sondern dem Verstande vorgestellt; sie kann nur gedacht werden, nicht erscheinen. Die architektonische Schönheit hingegen kann nie ein Ausdruck seiner Bestimmung sein, da sie sich an ein ganz anderes Vermögen wendet, als dasjenige ist, welches über jene Bestimmung zu entscheiden hat.
Wenn daher dem Menschen, vorzugsweise vor allen übrigen technischen Bildungen der Natur, Schönheit beigelegt wird, so ist dies nur in sofern wahr, als er schon in der bloßen Erscheinung diesen Vorzug behauptet, ohne daß man sich dabei seiner Menschheit zu erinnern braucht. Denn da dieses Letzte nicht anders als vermittelst eines Begriffs geschehen könnte, so würde nicht der Sinn, sondern der Verstand über die Schönheit Richter sein, welches einen Widersprach einschließt. Die Würde seiner sittlichen Bestimmung kann also der Mensch nicht in Anschlag bringen, seinen Vorzug als Intelligenz kann er nicht geltend machen, wenn er den Preis der Schönheit behaupten will; hier ist er nichts als ein Ding im Raume, nichts als Erscheinung unter Erscheinungen. Auf seinen Rang in der Ideenwelt wird in der Sinnenwelt nicht geachtet, und wenn er in dieser die erste Stelle behaupten soll, so kann er sie nur dem, was in ihm Natur ist, zu verdanken haben.
Aber eben diese seine Natur ist, wie wir wissen, durch die Idee seiner Menschheit bestimmt worden, und so ist es denn mittelbar auch seine architektonische Schönheit. Wenn er sich also vor allen Sinnenwesen um ihn her durch höhere Schönheit unterscheidet, so ist er dafür unstreitig seiner menschlichen Bestimmung verpflichtet, welche den Grund enthält, warum er sich von den übrigen Sinnenwesen überhaupt nur unterscheidet. Aber nicht darum ist die menschliche Bildung schön, weil sie ein Ausdruck dieser höhern Bestimmung ist; denn wäre dieses, so würde die nämliche Bildung aufhören, schön zu sein, sobald sie eine niedrigere Bestimmung ausdrückte; so würde auch das Gegentheil dieser Bildung schön sein, sobald man nur annehmen könnte, daß es jene höhere Bestimmung ausdrückte. Gesetzt aber, man könnte bei einer schönen Menschengestalt ganz und gar vergessen, was sie ausdrückt; man könnte ihr, ohne sie in der Erscheinung zu verändern, den rohen Instinkt eines Tigers unterschieben, so würde das Urtheil der Augen vollkommen dasselbe bleiben, und der Sinn würde den Tiger für das schönste Werk des Schöpfers erklären.
Die Bestimmung des Menschen, als einer Intelligenz, hat also an der Schönheit seines Baues nur in sofern einen Antheil, als ihre Darstellung, d. i. ihr Ausdruck in der Erscheinung, zugleich mit den Bedingungen zusammentrifft, unter welchen das Schöne sich in der Sinnenwelt erzeugt. Die Schönheit selbst nämlich muß jederzeit ein freier Natureffekt bleiben, und die Vernunftidee, welche die Technik des menschlichen Baues bestimmte, kann ihm nie Schönheit ertheilen, sondern bloß gestatten.
(Fortsetzung folgt)
Wenn man vielleicht etwas schockiert wahrgenommen hat (siehe Wikipedia-Artikel oben), wie realistisch „man“ in der Antike die Weiblichkeit einer Statue zur Kenntnis nahm,
Der Überlieferung zufolge war die Figur derart lebensecht, dass sich ein junger Mann in der Cella des Tempels einschließen ließ und mit ihr zu verkehren versuchte. Ergebnis dieser Bemühungen sei ein unauslöschlicher Fleck auf der Rückseite eines Oberschenkels gewesen, der offenbar tatsächlich vorhanden war und den Anlass zu dieser Erzählung gegeben haben könnte.
wird man auch Schiller leichter zugestehen, dass er die antike Kunst nicht nur unter dem Aspekt der „edlen Einfalt und stillen Größe“ gesehen hat, und dass in seiner Zeit ebenso wie 100 Jahre später fortwährend das Frauenbild moralistisch justiert oder entmythologisiert wurde. Daher habe ich an dieser Stelle für mich auch andere Lektüren interpoliert, in denen es um die Bedeutung der Renaissance für die deutsche Klassik geht und zugleich um die Gender-Motivik der heutigen Forschung. Z.B. in dem lesenswerten Buch Interkulturellr Transfer und nationaler Eigensinn Europäische und anglo-amerikanische Positionen der Kulturwissenschaften / Herausgegeben von Rebekka Habermas und Rebekka v. Mallinckrodt. Darin besonders interessant der Beitrag von Michael Wenzel über „Das weibliche Bildnis der Italienischen Renaissance“. (Siehe auch hier.)