Oder vielleicht auch gerade nicht…
Zitat (wörtlich, nur deutlicher gegliedert)
Es muß in allem, was ein lebhaftes, erschütterndes Lachen erregen soll, etwas Widersinniges sein (woran also der Verstand an sich kein Wohlgefallen finden kann). Das Lachen ist ein Affekt aus der plötzlichen Verwandlung einer gespannten Erwartung in nichts.
Ebendiese Verwandlung, die für den Verstand gewiß nicht erfreulich ist, erfreuet doch indirekt auf einen Augenblick sehr lebhaft. Also muß die Ursache in dem Einflusse der Vorstellung auf den Körper und dessen Wechselwirkung auf das Gemüt bestehen; und zwar nicht, sofern die Vorstellung objektiv ein Gegenstand des Vergnügens ist (denn wie kann eine getäuschte Erwartung vergnügen?), sondern lediglich dadurch, daß sie, als bloßes Spiel der Vorstellungen, ein Gleichgewicht der Lebenskräfte im Körper hervorbringt.
Wenn jemand erzählt: daß ein Indianer, der an der Tafel eines Engländers in Surate eine Bouteille mit Ale öffnen und alles dies Bier, in Schaum verwandelt, herausdringen sah, mit vielen Ausrufungen seine große Verwunderung anzeigte, und auf die Frage des Engländers: was ist denn hier sich so sehr zu verwundern? antwortete: Ich wundere mich auch nicht darüber, daß es herausgeht, sondern wie ihrs habt hereinkriegen können; so lachen wir, und es macht uns eine herzliche Lust: nicht, weil wir uns etwa klüger finden als diesen Unwissenden, oder sonst über etwas, was uns der Verstand hierin Wohlgefälliges bemerken ließe; sondern unsre Erwartung war gespannt, und verschwindet plötzlich in nichts.
Oder wenn der Erbe eines reichen Verwandten diesem sein Leichenbegängnis recht feierlich veranstalten will, aber klagt, daß es ihm hiemit nicht recht gelingen wolle; denn (sagt er): je mehr ich meinen Trauerleuten Geld gebe betrübt auszusehen, desto lustiger sehen sie aus; so lachen wir laut, und der Grund liegt darin, daß eine Erwartung sich plötzlich in nichts verwandelt. Man muß bemerken: daß sie sich nicht in das positive Gegenteil eines erwarteten Gegenstandes – denn das ist immer etwas, und kann oft betrüben –, sondern in nichts verwandeln müsse.
Denn wenn jemand uns mit der Erzählung einer Geschichte große Erwartung erregt, und wir beim Schlusse die Unwahrheit derselben sofort einsehen, so macht es uns Mißfallen; wie z.B. die von Leuten, welche vor großem Gram in einer Nacht graue Haare bekommen haben sollen. Dagegen, wenn auf eine dergleichen Erzählung zur Erwiderung, ein anderer Schalk sehr umständlich den Gram eines Kaufmanns erzählt, der, aus Indien mit allem seinem Vermögen in Waren nach Europa zurückkehrend, in einem schweren Sturm alles über Bord zu werfen genötigt wurde, und sich dermaßen grämte, daß ihm darüber in derselben Nacht die Perücke grau ward; so lachen wir, und es macht uns Vergnügen, weil wir unsern eignen Mißgriff nach einem für uns übrigens gleichgültigen Gegenstande, oder vielmehr unsere verfolgte Idee, wie einen Ball, noch eine Zeitlang hin- und herschlagen, indem wir bloß gemeint sind ihn zu greifen und festzuhalten. Es ist hier nicht die Abfertigung eines Lügners oder Dummkopfs, welche das Vergnügen erweckt: denn auch für sich würde die letztere mit angenommenem Ernst erzählte Geschichte eine Gesellschaft in ein helles Lachen versetzen; und jenes wäre gewöhnlichermaßen auch der Aufmerksamkeit nicht wert.
Merkwürdig ist: daß in allen solchen Fällen der Spaß immer etwas in sich enthalten muß, welches auf einen Augenblick täuschen kann; daher, wenn der Schein in Nichts verschwindet, das Gemüt wieder zurücksieht, um es mit ihm noch einmal zu versuchen, und so durch schnell hintereinander folgende Anspannung und Abspannung hin- und zurückgeschnellt und in Schwankung gesetzt wird: die, weil der Absprung von dem, was gleichsam die Saite anzog, plötzlich (nicht durch ein allmähliches Nachlassen) geschah, eine Gemütsbewegung und mit ihr harmonierende inwendige körperliche Bewegung verursachen muß, die unwillkürlich fortdauert, und Ermüdung, dabei aber auch Aufheiterung (die Wirkungen einer zur Gesundheit gereichenden Motion), hervorbringt.
Denn, wenn man annimmt, daß mit allen unsern Gedanken zugleich irgendeine Bewegung in den Organen des Körpers harmonisch verbunden sei: so wird man so ziemlich begreifen, wie jener plötzlichen Versetzung des Gemüts bald in einen bald in den andern Standpunkt, um seinen Gegenstand zu betrachten, eine wechselseitige Anspannung und Loslassung der elastischen Teile unserer Eingeweide, die sich dem Zwerchfell mitteilt, korrespondieren könne (gleich derjenigen, welche kitzlige Leute fühlen): wobei die Lunge die Luft mit schnell einander folgenden Absätzen ausstößt, und so eine der Gesundheit zuträgliche Bewegung bewirkt, welche allein und nicht das was im Gemüte vorgeht, die eigentliche Ursache der Vergnügens an einem Gedanken ist, der im Grunde nichts vorstellt. –
Quelle Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft (aus §54) zitiert nach Spiegel online Projekt Gutenberg hier Kapitel 64
Siehe auch: HIER (Artikel „Lachen mit Schopenhauer“)
Wie ich darauf komme? Durch Peter Szendy: „Tubes, Hits, Ohrwürmer“ / Die Philosophie in der Jukebox / Avinus Verlag Berlin 1012 / Seite 94 f. Eigentlich hatte ich mir „La Mer“ von Debussy in Erinnerung rufen wollen. Warum? Ich habe über einen Artikel nachgedacht zum Thema „Die Alte Musik und das Meer“, aber diesen Titel habe ich inzwischen fallen gelassen.
Und wie kam ich noch einmal bzw. wieder einmal auf Szendy? Durch einen „Tube“ von Charles Trenet. Auf Youtube. „La mer“!!! Wollen Sie ihn hören? Bitteschön (es ist nicht zum Lachen): hier.
Warum war ich fasziniert? Ich erkannte die Melodie, sobald sie sich in Bewegung setzte (ich hatte nicht damit gerechnet). Vielmehr, sobald das Klavier die Bewegung anführte (gebrochene Akkorde, Achtelaufteilung zu relativ schnellen Vierteln), die Melodie ist ruhig, Überraschung, den Dirigenten der Band zu sehen: er dirigiert schnelle Viertel, als sei es ein eiliges Stück. Vielleicht tut er es, weil die Streicher Harmonien in Pfundnoten spielen und zu präzisen Akkordwechseln angehalten werden sollen. Aber wenn man einmal darauf achtet, ist es ein komischer Effekt. Wie für musikalischen Analphabeten.) Die Melodie besteht nur aus Vorder- und Nachsatz, die bis auf die Schlusswendung identisch sind und so ineinandergreifen, dass man endlos wiederholen kann. Und in der Tat: der Hit verläuft genau auf diese Weise, wenn auch eine Rückung vorkommt (und wieder rückgeführt wird) und einige Wiederholungen vom Sänger improvisatorisch ausgeschmückt werden. Ich vermute, dass der Hit sich dank dieser Wiederholungstechnik so im Gehirn festhakt, dass er automatisch weiterläuft, wenn die Musik längst beendet ist. Zudem ist die erste Zeile tatsächlich ein schöner Einfall, den man nicht beginnt, ohne ihn dann auch weiterzusummen…)
Um es kurz zu machen: Charles Trenet kommt zwar in Szendys Buch vor, aber nicht als bedeutender Faktor. Dabei lese ich mich aufs Neue fest – ich muss auswählen, daher nur soviel: KANT wird anlässlich der Witz-Theorie von Freud zitiert -, aber ausführlich wird eine Arbeit des Psychoanalytikers Theodor Reik behandelt, insbesondere der Fall einer Patientin namens Cecily, die Opfer einer Zwangsidee geworden war: „Sie wusste nicht , warum sie davon überzeugt war, [dass] eine Reise nach Indien die notwendige Vorbedingung dafür sein sollte, ein Kind zu haben“. Und der Analytiker Reik fühlt sich – so berichtet Szendy – hilflos. Ich zitiere zwei Seiten (Seite 50f) aus Szendys Bericht, und nehme mir diese Freiheit, weil ich glaube, sozusagen Hilfestellung leisten zu können:
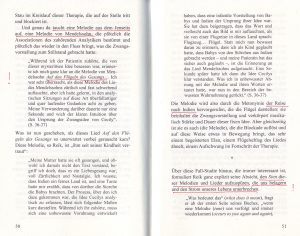 Peter Szendy „Tubes, Hits, Ohrwürmer“
Peter Szendy „Tubes, Hits, Ohrwürmer“
Wenn man das in der Tat wunderschöne Lied kennt, fällt einem auf, dass darin – anders als im Fall Cecily – von Indien gar nicht die Rede ist. Als die Mutter es sang, hat das Kind (Reik) den Text noch gar nicht verstanden, nur begriffen, „dass es ein Liebesgesang war, voll Zärtlichkeit und Nostalgie“. Erst die Tante hat offenbar Indien ins Spiel gebracht. Wer weiß, ob das kleine Kind schon nach dem Inhalt der dritten Zeile „Fort nach den Fluren des Ganges“ gefragt hat, der sich auf die erste Zeile reimt bzw. reimen müsste, denn die lautet korrekt: „Auf Flügeln des Gesanges“ (nicht: Gesangs!). Ich könnte mir eher vorstellen, dass das Kind dies Wort auf seine Art gedeutet hat: „Flur“ und „Gang“ ist ungefähr dasselbe. (Das wird hier irgendwo in der Wohnung sein!) Ein Beispiel: Zu meinen ersten Liedern gehörte „Hänschen klein“, und ich habe jahrelang geglaubt, darin sei von einer Gabel die Rede: „Gabel sind sich das Kind, läuft nach Haus geschwind“. Ein Kleinkind ist stolz, wenn es bei Tisch ein so gefährliches Werkzeug benutzen darf; aber was es nicht kann, ist: abstrakt denken im Sinne von „da besinnt sich das Kind“.
Mit andern Worten: ich traue dem Bericht nicht. Ich glaube nicht, dass er wirklich von der Melodie initiiert ist, sondern von Wort-Assoziationen, die sich im Laufe der Jahre an Textbestandteile geheftet haben. Dass diese sich gehalten haben, mag an der Melodie liegen. Oder an Bildern, die sich mit ihr verbunden haben.
Szendy verfährt ähnlich und kommt zu einem interessanten Schluss:
Das gesetzte Ziel seiner musikpsychologischen Untersuchung, die den Sinn, die Bedeutung (meaning) erforschen will, wird Reik jedoch rasch in eine Sackgasse führen. Ganz in der großen romantischen Tradition absoluter Musik geht er nämlich davon aus, dass die Melodie als solche „eine Botschaft ist, die jeder versteht, ohne dass man sie gleich übersetzen kann“ (S.7). Was Reik jedoch fortwährend tut, ist genau dies: übersetzen und die Musik in einen bedeutungsvollen Diskurs einschreiben. Wenn er z.B. schreibt, dass „in der Menge der freien Assoziationen Fetzen von Liedern an bestimmten bedeutungsvollen Stellen verstreut sind“ (S.10), so ist klar, dass der Sinn, dass die Bedeutung, die der implizite Diskurs, der durch eben diese Assoziationen entstanden ist, geformt hat. Ob der Sinn nun schon da ist oder ob er noch fehlt – weil verborgen in den Lücken des Bewusstseins oder des Unbewussten -, für Reik scheint diese Sinn der diskursiven Art anzugehören.
Ich mache einen Sprung in Szendys Entwicklung des Gedankens und zitiere, was für ihn nun „das Genuine der Musik, was das musikalisch Zwingende bzw. Zwanghafte [ist], das von diesen besitzergreifenden Melodien ausgeht“; er wagt die Hypothese,
dass es hier nicht um einen Unterschied des Sinns, sondern um einen Unterschied der Kraft, der Intensität geht. Was das (relativ) Eigentliche der Musik ausmachen könnte, das wäre nicht ihr eigener Sinn, sondern diese Kraft, sich ein- und auszuklinken, da und wieder fort zu sein, die ihre Störungen und Unterbrechungen so explosiv und heftig macht. Über all die endlosen Diskurse hinaus, die Reik zu Recht oder zu Unrecht wiederzufinden glaubt, indem er sie den heimsuchenden Melodien überstülpt, die er examiniert, ist doch das, was diesen Musik-Phantomen gemeinsam ist, im Grunde ihre Kraft, einfach plötzlich aufzutauchen.
Nachtrag 8. Februar 2018
Nachdem ich vorgestern das Kölner Gürzenich-Orchester live im Internet erlebt habe (siehe hier), möchte ich an dieser Stelle einen bemerkenswerten Auftritt des Gürzenich-Chefs François-Xavier Roth hervorheben. Eben erst entdeckt.