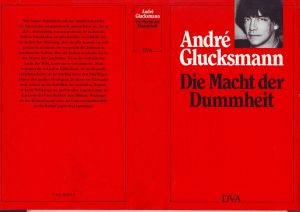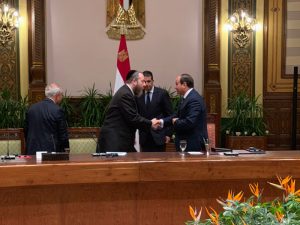Die Tageszeitung als Katalysator
Ein Beispiel: man wacht am Morgen auf und ist gut gelaunt, – ohne zu wissen warum. Man ist halt lebendiger als in der Nacht um eins, als man einschlief. Und noch beim Lesen der Zeitung sucht man nach Stoff, der zum Lebendigerfühlen passt, man bleibt hängen bei bestimmten Punkten der Synapsenbildung. In der SZ beginnend bei dem Namen (und dem Gesicht) „Glucksmann“, wie war der Vorname? André, das war der, dessen Buch ich damals nicht gelesen habe, es steht im Keller, am Klavier muss ich mich nur um 180 Grad drehen, um es aus dem Regal zu greifen. Über die Dummheit. Ich las es nicht, es war mir zu rechts (? – ein Geigenschüler hatte es mir geschenkt, um mich von Adorno zu lösen). Und nun der Sohn namens Raphaël (den ich bis dato nicht kannte).
Mit einer Ästhetisierung der Politik suche Macron den realen Machtverlust des Staatslenkers, der zusehends den Spielregeln der Märkte ausgesetzt ist, mehr zu überspielen als zu bekämpfen. Hinter seinem „enthusiastischen Konformismus“ werde paradoxerweise ein Mangel an politischer Ambition erkennbar.
Aus dieser kritischen Position heraus strebt Glucksmann ein linkes Gegenprogramm ökologischer Ausrichtung an. Das vorliegende Buch steckt dafür das Ideenfeld ab. Mit seinem Plädoyer für eine „tragische Ökologie“ beispielsweise will der Autor die Klima- und Umweltfrage aus der Perspektive abstrakter Hypothesen in den Horizont des „Tragischen“ überführen, in dem das Ende unserer Welt die höchstwahrscheinlich auf uns zukommende Lebensrealität ist.
Hat das mit der seltsamen Ästhetisierung des Katastrophischen zu tun, die ich vor einigen Tagen verwundert zur Kenntnis nahm, siehe Rauterberg hier? Mein Missverständnis wahrscheinlich, ich brauche mehr Text; es erinnerte mich eben noch an die Parade in Paris, auch YoYo Ma spielte, und zwar die tragische Sarabande aus der Bach-Suite C-moll:
Macron wollte die in Frankreich blockierten Energien freisetzen, sein Land aus dem rebellischen Abseits holen und den Gegebenheiten der Welt anpassen, ist nach Ansicht Gluckmanns aber unfähig, die von der Globalisierung verunsicherten Bevölkerungsschichten anzusprechen.
„Ihr seid Zehntausende und ich sehe nur ein paar Gesichter“ – dieser vom jungen Präsidenten in der Wahlnacht vor zwei Jahren im Louvre an sein Publikum gerichtete Satz machte für Glucksmann Macrons Volksblindheit offensichtlich. Er spreche zu einer Vielzahl von „Ichs“, sei als Sprössling der individualistischen Revolution aber zu keiner anderen Vorstellung des „Wir“ fähig als jener, die spiegelbildlich aus der Eigeninszenierung seiner Macht und aus der Beschwörung historischer Mythen hervorgehe.
Quelle Süddeutsche Zeitung 6. August 2019 Seite 11 Die leere Menge Jenseits von intellektueller Überheblichkeit und moralischer Rechthaberei: Raphaël Glucksmann versucht, den Gesellschaftsvertrag neu zu begründen / Von Joseph Haniman
Der andere „Stoff“ stand im Tageblatt und erinnerte mich merkwürdigerweise an das vor einigen Tage gesehene Youtube-Video, das Henryk M. Broder bei einer Rede vor der AfD zeigt und mir als eine von prekärem Witz gezeichnete Veranstaltung in Erinnerung blieb. Wie er, im peinlichsten Einvernehmen badend, die Klimakatastrophe ironisierte. Diese unkenntliche Vermischung von intellektueller Arroganz und André-Glucksmannscher Dummheit. Man möchte es vergessen, aber es bildet ein Schleife des Erinnerns. (Damals vor 40 Jahren im WDR, als eine Kollegin den offenbar undankbaren Broder als ihre „Entdeckung“ reklamierte.) Schließlich ein fast therapeutisches Thema – als Frucht der Sommerlocherntezeit – „Der Witz als Forschungsobjekt“.
Worüber gelacht wird, hängt sehr stark mit dem kulturellen Repertoire, dem kollektiven Gedächtnis und dem Selbstbild einer Gesellschaft zusammen. Deshalb könne der Humor auch ganz schnell kippen und etwas Beleidigendes und Verletzendes bekommen, wenn Beteiligte einen anderen kulturellen Hintergrund besäßen. Als Beispiel nennt der 45-Jährige den Karikaturenstreit. „Im Westen gehört es mittlerweile meist zum Standard, selbst religiöse Autoritäten zu verlachen. In muslimischen Ländern ist das aber ganz und gar nicht so.“ Da die Menschheit in einer globalisierten Welt lebe, würden die unterschiedlichen Humorkulturen heute sehr viel schneller aufeinanderprallen als noch vor 100 Jahren: „Dann wird aus Humor ganz schnell Verletzung, weil man selbst andere Tabutoleranzen hat.“
Doch in vielen Fällen lache die Welt gemeinsam über dieselben Sachen, meint Koch. [Beispiele Charlie Chaplin oder Mr. Bean].
Quelle Solinger Tageblatt 6. August 2019 Seite 23 Der Witz als Foschungsobjekt Humor kann durchaus eine ernste Sache sein. An der TU Dresden widmet sich ein Forscher Witzen mit viel Ernst. Für ihn [Lars Koch] gehören Humor und Lachen zum Menschen wie das Herz oder der Verstand. / Von Jörg Schurig.
Auf die Unterschiede kommt es letztlich an. Ob man eher über Mario Barth lacht oder über Olaf Schubert. Slavoj Žižek ist für mich erledigt, seit ich seine Witze kenne bzw. das ganze enthemmte Interview im SZ-Magazin vom 2. August; dabei nehme ich ein paar heikle Stellen aus, z.B. über die Korrektheit in der Sexualität, wo er verständlicherweise dem Mainstream vor den Kopf stoßen will. Ich meine auch nicht seinen leicht pöbelhaften Ton; dergleichen hat seltsamerweise Nietzsche salonfähig gemacht. Unerträglich eher, dass er die Kategorie „geschmackloser Witze“ bedient, selbst zu der Frage „Wo war Gott in Auschwitz“. Andererseits habe ich sein „Parallaxe“-Buch wieder vorgenommen (das einzige von Žižek, das ich besitze, aber nur kursorisch gelesen habe), – ich bin nicht sicher, ob er wirklich was von Musik versteht, oder nur das, was sich in zugeordneten Texten als „Narrativ“ anbietet. Seine Assoziationsketten und Gedankensprünge, scheint mir, suggerieren neben souveräner Themenbeherrschung die Neigung zu bloßer Selbstinszenierung.
Ende der 80er Jahre las man an manchen PKWs ein Spruchband, das witzig sein sollte: „Mein Auto fährt auch ohne Wald“. Wer weiß, ob sich das heute noch jemand trauen würde. Ich studiere als Korrektiv zu widersprüchlichen Zeitungsberichten parallel die beiden Büchlein von Paech (und Eppler), die später zum Thema werden sollen, aber angesichts des Hitzerekordes und des vertrocknenden Waldes macht man keine Witze mehr (außer vielleicht Henrik M. Broder), man greift wieder einmal nach dem Strohhalm, oder ich darf sogar sagen: Strohbaum. Zitat aus der NZZ:
In der langen Lebensdauer eines Baumes von 150 Jahren wechselten sich immer wieder schlechte mit guten Jahren ab. So war zum Beispiel 2017 ein sehr gutes Jahr für das Wachstum. Und auch 2018 konnten viele Bäume nach einer «Sommerpause» noch Holz bilden. Sanders [Tanja Sanders, Leiterin des Arbeitsbereichs Waldökologie und Biodiversität am Thünen-Institut in Eberswalde] mag jedenfalls nicht von einem Waldsterben sprechen, sondern nennt es ein Baumsterben.
Baumsterben statt Waldsterben
Der Wald wird in Mitteleuropa nicht grossflächig verschwinden. Trotzdem sei die Lage vieler Waldeigentümer angespannt, gibt Peter Elsasser vom Thünen-Institut für internationale Waldwirtschaft und Forstökonomie in Hamburg zu bedenken. Er erklärt das an einem Beispiel: Wenn in einem Wald Bäume im Mittel hundert Jahre alt werden, kann jedes Jahr 1 Prozent geerntet werden, damit er im Gleichgewicht bleibt. Wenn nun wie letztes Jahr rund 0,5 Prozent der Bäume absterben oder geschädigt werden, ist das für den Wald selbst noch verkraftbar. Für die Waldbesitzer heisse dies aber, dass sie auf die Hälfte des kompletten Jahresumsatzes verzichten müssten.
Quelle: Neue Zürcher Zeitung 6.8.2019 Deutschland beklagt das «Waldsterben 2.0», aber wie schlecht geht es dem Wald wirklich? In Mitteleuropa nehmen die Waldschäden zu. Deutsche Waldbesitzer sprechen bereits von einer «Jahrhundertkatastrophe», ihre Schweizer Kollegen sind nervös. Experten sprechen jedoch lieber von einem Baum- statt einem Waldsterben. / Von Christoph Eisenring, Berlin.
Nachtrag: siehe dazu auch: DIE ZEIT 8. August 2019 (online hier) Selbst ist der Wald Die aktuelle Forstpolitik droht alte Fehler zu wiederholen / Von Fritz Habekuss
Sie erraten es, inzwischen habe ich im Keller Klavier geübt (Brahms op.117 Nr.2) und bin mit dem Buch von André Glucksmann zurückgekehrt. Es war damals (1985) eine Dummheit, es nicht zu lesen, oder jedenfalls nur in Stichproben. Seite 167 sehe ich einen wunderbaren Vorspruch, der von Immanuel Kant stammen soll:
Voltaire sagt, der Himmel habe uns zum Gegengewicht gegen die vielen Mühseligkeiten des Lebens zwei Dinge gegeben: die Hoffnung und den Schlaf. Er hätte noch das Lachen dazu rechnen können; wenn die Mittel es bei Vernünftigen zu erregen nur so leicht bei der Hand wären, und der Witz oder die Originalität der Laune, die dazu erforderlich sind, nicht eben so selten wären, als häufig das Talent ist, kopfbrechend wie mystische Grübler, halsbrechend wie Genies, oder herzbrechend wie empfindsame Romanschreiber (auch wohl dergleichen Moralisten) zu dichten.
Glucksmann hat das Zitat aus der Kritik der Urteilskraft, dank Google leicht zu finden: hier.
Vorgestern, am Sonntagmorgen habe ich mein Elternhaus (seit 1954) in Bielefeld wieder aufgesucht, stark verändert durch den metallenen Zugang, aber praktischer als damals (wir betraten das Haus von der Giebelseite her durch den Keller). Mein Zimmer ganz oben links, das Fenster ist durch Blätter verdeckt. Gern hätte ich die junge Dame dort gefragt, ob im Mai die Nachtigall noch oben im Garten singt, aber die Antwort hätte wohl nicht in ihr Handy-Gespräch gepasst.
Es ist nicht die Veränderung, die mich schlagartig traurig stimmt, es ist die Erinnerung an das Glück der 50er Jahre, das auf letztlich ganz unbegründeten Hoffnungen beruhte. Mein Vater starb, aber die Zukunft schien glänzend.
Lieber will ich – näher an der Realität – weiterlesen:
Wer je das Wort „Tragik der Allmende“ richtig begriffen hat (siehe auch hier), wird erschrecken, wenn er allenthalben einer ähnlichen Aporie bei scheinbar aussichtsreichen Neuerungen begegnet. Gleich folgt eine Beispielseite aus dem danach abgebildeten Buch. Es geht um Nebenwirkungen innovativer, durchaus intelligenter Entwürfe, nach deren Umsetzung es plötzlich für Korrekturen zu spät ist: [ZITAT] erstens weil die bereits eingetretenen ökologischen und gesundheitlichen Schäden nicht mehr rückgängig zu machen sind, zweitens [und nun lesen Sie bitte im Scan weiter: insbesondere den Satz von den Verwertungsinteressen, die sich herausgebildet haben und sich bestens zu verteidigen wissen, sowie von der unverzichtbaren Symbolik für individuelle Selbstdarstellung! Es ist völlig klar, dass sich auch hier das Wort TRAGIK einstellen wird:]
Ich hatte in einem früheren Blogbeitrag bereits einen erhellenden Vortrag von Niko Paech verlinkt und tue es hier noch einmal, um an einem allzu selbstgefälligen Kulturbewusstsein zu rütteln, das auch mir – so fürchte ich – nicht fremd ist; und neuerdings bedient es sich argumentativ bei Niko Paech, wenn ich mich nicht irre. Ich lese bei dem hochgeschätzten Hanno Rauterberg:
Kann eine Kunst, die das Gute und Richtige propagiert, mehr sein als ästhetischer Ablasshandel?
Niemand der die Biennale in Venedig besucht, die gerade ganz im Zeichen des Klimawandels steht, muss erst davon überzeugt werden, dass Plastik im Meer nichts zu suchen hat. […]
Wenn sich aber Künstler und Publikum so wunderbar einig sind, entwickelt die Kunst weniger eine aufklärende als eine besänftigende Wirkung. Der Besucher investiert Geld und Zeit, um die Werke zu betrachten, und bekommt im Gegenzug das gute Gefühl vermittelt, selbst keiner der geschmähten Touristen zu sein, sondern etwas ganz anderes, etwas Besseres: ein Reisender in Sachen Kultur, der garantiert auf der richtigen Seite steht. Gerade dieses Wohlgefühl ist natürlich die beste Voraussetzung dafür, dass alles schön beim Alten bleibt.
Wie wirkungslos eine sozial und politisch gepolte Kunst in der Regel ist, zeigt sich bereits daran, dass Künstler-Appelle grundsätzlich nur die anderen meinen. Diese anderen sind es, nicht die Künstler selbst, auch nicht die Museen, Theater oder Filmstudios, die sich ganz dringend ändern sollen. Es gilt die alte Regel: Je moralisierender das Pathos der Kunst, desto schwächer die Bereitschaft zur Selbstkritik.
(Bemerken Sie, wie schlau ich vor diesem Zitat Selbstkritik habe aufleuchten lassen, um ja nicht selbst in die Schusslinie zu geraten!? Und nun folgt die Quelle des Zitates, danach aber gleich die Fundstelle im Paech-Vortrag, an der der Mechanismus mit der Selbstreinigung durch Ablasshandel studiert werden kann.)
Quelle DIE ZEIT 1. August 2019 Seite 33 Die Kunst der Scheinheiligkeit Natürlich ist die Kulturwelt ganz entschieden für den Klimaschutz – und produziert doch Treibhausgase in gigantischem Ausmaß. Ist das der Preis der Weltläufigkeit? Von Hanno Rauterberg.
Und nun noch einmal – Stichwort Ablasshandel – der Link in den Paech-Vortrag HIER , gehen Sie dort aber gleich auf den Punkt 24:12, Textbeginn „Vor 500 Jahren hat Martin Luther den Anschlag zu Wittenberg verübt“.
Nachtrag zum Rebound-Effekt
Der wurde schon 1865 von einem britischen Wirtschaftswissenschaftler entdeckt. Die Wirkungsweise ist simpel: Alles, was eingespart wird, wird woanders investoiert. Unternehmen steigern ihren Umsatz, die Profite stecken sie in die Entwicklung neuer Produkte oder in die internationale Ausdehnung, was wiederum mehr Nachfrage zur Folge hat. Und Konsumenten sparen durch Effizienzsteigerung Kosten: Wer ein Elektroauto fährt, spart Benzin. Und was macht er oder sie mit dem Gesparten? Es wird höchstwahrscheinlich in ein anderes Konsumgut gesteckt. Effizienzsteigerung führt zu noch mehr Konsum. (…)
Niemand weiß, wie Wohlstand ohne Wachstum aussähe. Allerdings weiß auch niemand, wie eine durch Erhitzung der Atmosphäre veränderte Natur sich auf die Wirtschaft auswirken wird. Tatsache ist, dass Effizienzsteigerung bei gleichzeitigem Wirtschaftswachstum allein nicht zur Reduktion von CO²-Emissionen geführt hat, und wenn es in der Vergangenheit nie funktioniert hat, taugt es vermutlich auch nicht ohne Weiteres als Zukunftsmodell.
Quelle DIE ZEIT 8. August 2019 Seite 3 Der Schein trügt Die Grünen nennen ihre Politik gern radikal. Wer das glaubt, sollte mal ihr Programm lesen. Wenn es verwirklicht wird, ändert sich: Nicht viel / Von Elisabeth Raether
Anschließend wäre noch zu empfehlen: das Gespräch zwischen Cem Özdemir und VW-Chef Herbert Diess, – der in einzigartiger Logik darlegt, weshalb er möglichst viele SUVs verkaufen muss, um sich die Entwicklung des extrem klimafreundlichen Elektroautos leisten zu können.
Quelle DIE ZEIT 1. August 2019 Seite 20 Ist das Auto schuld am Klimawandel ? Der Grünen-Politiker Cem Özdemir und VW-Chef Herbert Diess über SUVs, das Ende des Verbrenners und die dreckige Seite der E-Mobilität. [Online abzurufen hier.]
Heute, am 7. August 2019, lese ich noch etwas anderes, an die Stelle des oben erwähnten Vitalprotzes Žižek tritt eine Frau, deren Namen ich bisher nicht kannte, 1937 als Tochter jüdischer Eltern im algerischen Oran geboren, seit 1955 in Paris lebend.
Natürlich ist es wichtig, dass Frauen schreiben. Aber, und das ist etwas, das ich schon im Lachen der Medusa schrieb, jede große Literatur hat Merkmale dieser Weiblichkeit, egal ob sie von einer Frau oder einem Mann unterschrieben ist. Das ist das Geheimnis des Schreibens. Meine persönliche Bibliothek ist voller lebender Toter, sie schreiben alle, sie erschaffen alle Figuren, die so kraftvoll menschlich sind. Sehen Sie zum Beispiel Dostojewski an: Im echten Leben war er ein Mann mit allen Schwächen des Mannes, der vollkommen von seiner Frau abhängig war, die sein Überleben gesichert hat. In seinem Schreiben wird dieser Mann Nastassja Filippowna – eine Frau unter Frauen, mit all dem Begehren und der Verzweiflung echter Frauen. Das ist das Wunder des Schreibens. Aber es gibt nur wenige Schreibende, die dieses Menschliche schaffen können, die diese vollständige Öffnung vollziehen können, der immer eine Weiblichkeit zugrunde liegt.
Quelle DIE ZEIT 8.August 2019 Seite 37 Ist die Frage nach der Frau noch wichtig? Ein Gespräch mit der Pariser Philosophin und Schriftstellerin Hélène Cixous. Von Anna Gien. [Über Das Lachen der Medusa siehe hier]
In derselben Viertelstunde lese ich in der Süddeutschen den Text einer Schriftstellerin, die 1981 in Petersburg geboren ist und als Kind nach Deutschland kam.
Eine schwäbische Kleinstadt, die vierte Klasse, Mai 1992: Ich verstehe Mathe – die Zahlen – und Musik – die Noten. Sonst verstehe ich nichts. Deutsch, Heimat- und Sachkunde, und was man sonst in der Grundschule so lernt, sind keine Fächer, weil sie Farben sind. Das sehe ich, erst verwundert, dann bewundernd. Jedes Fach scheint einen andersfarbigen Heftumschlag zu haben. (…)
In Mathe schreibe ich geliebte Zahlen, sie ergeben einen Sinn. Ich schreibe die Lösungen so schnell herunter, dass es dem Lehrer auffällt, der mich an die Tafel ruft. Dorthin schreibt er eine Aufgabe, die schwieriger ist, als was wir bis eben gerechnet haben. Das Ergebnis weiß ich, ich grabe in meinen Deutschkenntnissen nach den deutschen Zahlen. „Fünfunddreissig“, sage ich, ich flüstere es. Die Sprache muss ich noch lernen, und die Lautstärke muss ich noch lernen. Und erst recht „ich“ in dieser Sprache sagen. Der Lehrer sagt nichts. Ich sage auch nichts, ich rechne noch einmal im Kopf. Und noch einmal, obwohl das Ergebnis stimmt. Da drückt er mir die Kreide in die Hand, ich soll die Zahl an die Tafel schreiben.
Es ist klar, wie die Geschichte endet. ich schreibe das richtige Ergebnis, die Dreiundfünfzig an die Tafel, das soll mal einer verstehen, warum die Deutschen die Zahlen richtig herum schreiben, aber falsch herum aussprechen. Da klatscht der Lehrer, dann klatschen sie alle, die Deutschen klatschen, für mich. Die Deutschen, unter denen mehrere türkisch-, polnisch-, kroatisch- und so weiter-stämmige Schüler und Schülerinnen sitzen, aber auch das verstehe ich noch nicht. Der Lehrer schickt mich von Tisch zu Tisch, ich soll den anderen beim Rechnen helfen. Er nennt mich Matheexpertin. Er fragt herum, ob jemand dem Schriftstellerklub beitreten will, den er heute mit mir begründet habe.
Quelle Süddeutsche Zeitung 8. August 2019 Seite 9 Vierte Klasse, keine Deutschkenntnisse Wie ich eine schwäbische Grundschule überstand und Schriftstellerin wurde. Von Lena Gorelik.
 SZ 6. August 2019 Seite 12 (Sofia Glasl)
SZ 6. August 2019 Seite 12 (Sofia Glasl)
Gestern fragte ich C.A. per Mail, was sie von diesem neuen Buch über Tango halte, heute antwortet Hélène Cissoux in der ZEIT (Quelle s.o.):
In den letzten Jahren, wenn mich eine Arbeit – und es ist immer die ganze Arbeit, nicht ein einzelnes Buch – aufgewühlt hat, waren es leider immer Werke von Männern. Der portugiesische Schriftsteller António Lobo Antunes war eine Offenbarung für mich. Er ist mir nicht so nahe wie Clarice. Antunes ist ein Psychiater, und seine Welt ist nicht meine Welt. Es ist eine Welt voller Gewalt und Sex, aber sein Schreiben ist absolut herausragend.
Das heißt: wenn gleich geöffnet sein wird, rufe ich meine Buchhandlung an: bitte gleich zweimal für mich (und meine Tochter XX). Siehe hier.
 das Bielefelder Elternhaus am 4. August 2019
das Bielefelder Elternhaus am 4. August 2019
Die Holzwand müsste tiefbraun sein, nicht schmutzig-weiß. Da oben, hinter den Rosen, am Hang der Promenade, die bis zur Sparrenburg führt, sang im Frühling die Nachtigall. Im Verandazimmer starb 1965 meine Loher Großmutter in den Armen meiner Mutter.
Der Garten, der weiter oben schon in Wildnis überging, am vergangenen Sonntag noch wie vor 60 Jahren, gehörte zu den prägenden Erinnerungen. Was ich heute hier bei uns sehen will, ist nichts anderes als eine erweiterte Reminiszenz der Verhältnisse damals. Entscheidendes Kriterium, – was ich höre: wieviel Vögel singen. (Die Nachtigall fehlt in Solingen.)
An der Wand der Sohn, seit 1944 in Russland vermisst. Sie warteten immer noch auf ihn. Eines Tages in den 50ern hatten sie jemand bestellt, der einen Ring über dem Foto pendeln ließ, das Ergebnis war positiv… (die Realität nicht).