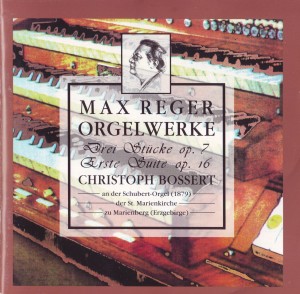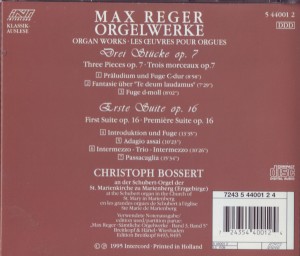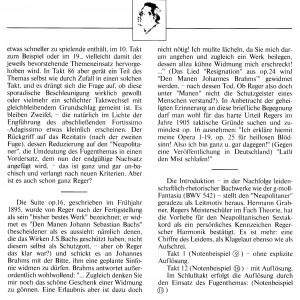Ich gebrauche selbstgemachte Fotos so, wie ich einem Menschen was vorsinge, zum Beispiel um über eine Melodie zu sprechen, die wir beide kennen: ich will nicht Kunst produzieren, nicht beweisen, dass ich einmal Gesangsstunden hatte, lächerlich, ich brauche kein schön geschnitztes Zeigestöckchen, wenn ich eine Straßenverbindung auf der Landkarte bezeichnen will. Natürlich weiß ich, dass es eine Kunst ist, gute Fotos zu machen; aber es ist zumindest subjektiv vertretbar, Fotos ohne jede Kunstabsicht herzustellen. Etwa so, wie man sich Notizen macht.
Vorgaben zur Kritik:
- Fotos geben vor, aus einer schönen Zeit zu stammen, – jeder ahnt den freundlichen Betrug -, die Personen lächeln, sie sollen den Betrachter für sich gewinnen: man wollte die Situation für ein späteres Erinnern festhalten, vielleicht weiß man, bezweckt es sogar, dass man den Betrachter durch schönen Schein manipuliert. Vielleicht wünscht man, dass das Foto so etwas wie Neid erweckt, man vermutet nicht, dass der wahrscheinlichere Effekt Mitleid ist: „Damals ahnte er noch nicht, dass er bald sterben würde!“ Oder sogar Schadenfreude?
- Fotos lassen das Elend, den Niedergang, den Zerfall des Alltags in seine heterogenen Einzelteile optisch attraktiv erscheinen. Man hört und riecht ja nichts, weder Stöhnen noch Gestank. Fotos klammern entscheidende Aspekte aus: z.B. die unerträgliche Hitze, die Mückenplage, die schrille Musik aus den Lautsprechern im Hintergrund. Fotos zielen selten darauf, dass man die Phänomene ergänzt, die nicht optischer Natur sind. Oder umgekehrt: sie spiegeln vor bzw. lassen keinen Zweifel zu, dass der Mensch, der eine Flöte an den Mund setzt, sie auch spielt.
- Fotos stammen aus einer anderen Welt, auch wenn ich selbst darauf abgebildet bin und offensichtlich teilgenommen habe. Ich würde nicht soweit gehen wie Hofmannsthal, nämlich zu sagen, ich sei „mir wie ein Hund unheimlich stumm und fremd.“ Ich sehe mich ja nicht nur, wie ich damals war (oder wie ich mich sehen wollte – wer weiß, wie viele andere Fotos ich habe verschwinden lassen); ich ergänze unwillkürlich aus der Erinnerung eine bestimmte (oder verschwimmende) Innenansicht. Ich könnte sie durch Notizen aus der Zeit vervollständigen. Und wenn das Foto an einem Festtag entstand, der mir im Gedächtnis haften geblieben ist, z.B. die Silberhochzeit meiner Eltern , kann ich viele Einzelheiten der äußeren Situation rekonstruieren.
- Fotos unterliegen krassen Fehldeutungen. Meine Mutter zeigte gern das Bild einer jüngeren Freundin und sagte, sie habe ein Problem, weil sie keinen Mann „mitgekriegt“ hat. Es war eher ein Zufallsfoto, auf dem die Dame seitwärts in die Landschaft schaute und zudem nicht lächelte, daher war es für jede Projektion sehnsüchtiger Gefühle geeignet. Ich kannte sie allerdings als eine lebenslustige Person und mochte nicht glauben, dass ausgerechnet dieses Foto ihr Innenleben offenbarte. Vielleicht war sie kurzsichtig und wirkte deshalb beim Blick in die Ferne leicht angestrengt. Und es gab für sie gute Gründe, gerade meiner Mutter ein Foto zu schicken, das nicht suggerierte, sie nehme das Leben allzu leicht. Traurig war sie wohl nicht.
Ich mache einen Versuch:
„Draußen“ herrscht der Erste Weltkrieg. Der Mann ist nur auf Urlaub. Er ist genauso streng, wie er aussieht. Die Mutter sieht keine rosige Zukunft vor sich, sie wird in der Sekte bleiben, die der Mann aufgegeben hat. Der Junge wird als immer noch junger Mann im Zweiten Weltkrieg sterben. Das Mädchen wird sich mit dem Vater überwerfen, schwere Krankheiten erleben und vier Kinder gebären. Sie wird vom Tag des Fotos an noch fast 90 Jahre leben.
Natürlich lächeln sie alle nicht. Das war damals auf dem Lande nicht üblich. Die Sekte hieß übrigens „Ernste Bibelforscher“.
Aber was ich ausdrücken wollte, war etwas anderes. Ich erinnere mich, dass ich dazu einiges nachlesen wollte. Roland Barthes, Susan Sontag, Siegfried Kracauer, – es soll folgen und irgendwie zur Lösung der Titelfrage beitragen.
Nur vorläufig setze ich ein Foto hierher, das von dem ehemals kleinen Mädchen 1952 geknipst wurde, meiner Mutter. Ich vermute es, denn ihr Stuhl ist leer. Links mein Vater, hinten Tante Bertha, übrigens seine alte Tante, die ihn um mindestens 6 Jahre überlebte, und rechts sitze ich und schaue heraus wie mein Vater. Ich glaube, es ist vor allem die trübe Beleuchtung, die mich beschäftigt, es ist das Licht, das traurig macht. Auch die gefüllte Tasse meiner Mutter. In Wahrheit war es heller. Aber das Bild hat auf andere Weise recht.
Ein Factum, das – vielleicht unnötig – traurig stimmt: all den Menschen, die wir auf alten Fotos betrachten, ist unbekannt, was vor ihnen liegt. Wir wissen es, wir kennen es – ihr „Fatum“. Vielleicht ist es ihnen aber gleichgültig, weil sie mit diesem Augenblick einigermaßen zufrieden sind? Sie alle leben (noch) und vergewissern sich dessen im Foto. Aus meiner Innensicht: mit 11 Jahren schien mir die Zukunft jenseits der 20, falls ich sie in Betracht zog, potentiell unendlich. Heute erfüllt mich mein damaliges Nichtwissen – fast ebenso wie das der anderen – mit Mitleid.
***
Aus Susan Sontag: „Über Fotografie“ (Fischer Taschenbuch Frankfurt am Main 1980, 2006)
Seite 14
Fotografieren wird zu einem Ritus des Familienlebens in eben dem Augenblick, da sich in den industrialisierten Ländern Europas und Amerikas ein radikaler Wandel anbahnt. Als jene klaustrophobische Einheit der Kernfamilie, aus einem sehr viel umfassenderen Familienkollektiv herausgelöst wurde, beeilte sich die Fotografie, die gefährdete Kontinuität und den schwindenden Einflußbereich des Familienlebens festzuhalten und symbolisch neu zu formulieren. Jene geisterhaften Spuren, die Fotografien, sorgen jetzt für die zeichenhafte Präsenz der verstreuten Angehörigen. Das Fotoalbum einer Familie bezieht sich im allgemeinen auf die Familie im weiteren Sinne – und ist häufig alles, was davon übriggeblieben ist.
Seite 21
(…) Die Fotografie ist eine elegische Kunst, eine von Untergangsstimmung überschattete Kunst. Die meisten Menschen, die fotografiert werden, haben, gerade weil sie fotografiert werden, etwas Rührendes an sich. Ein häßliches oder groteskes Modell kann rührend wirken, weil es der Fotograf seiner Aufmerksamkeit gewürdigt hat. Ein schönes Modell kann wehmütige Gefühle hervorrufen, weil es, seitdem die Aufnahme gemacht wurde, gealtert, verblüht oder gestorben ist. Jede Fotografie ist ein memento mori. Fotografieren bedeutet teilnehmen an der Sterblichkeit, Verletzlichkeit und Wandelbarkeit anderer Menschen (oder Dinge). Eben dadurch, daß sie diesen einen Moment herausgreifen und erstarren lassen, bezeugen alle Fotografien das unerbittliche Verfließen der Zeit
***
In einem seiner Essays, die zwischen 1920 und 1931 entstanden, denkt Siegfried Kracauer über das Porträt (s)einer Großmutter aus dem Jahre 1864 nach, die damals ein junges Mädchen war.
Die Enkel lachen über die Tracht, die nach der Verflüchtigung ihres Trägers allein den Kampfplatz behauptet – eine Außendekoration, die sich verselbständigt hat -, sie sind pietätlos, und heute kleiden die jungen Mädchen sich anders. Sie lachen und zugleich überläuft sie ein Grausen. Denn durch die Ornamentik des Kostüms hindurch, aus dem die Großmutter verschwunden ist, meinen sie einen Augenblick der verflossenen Zeit zu erblicken, der Zeit, die ohne Wiederkehr abläuft. Zwar ist die Zeit nicht mitphotographiert wie das Lächeln oder die Chignons, aber die Photographie selber, so dünkt ihnen, ist eine Darstellung der Zeit. Wenn nur die Photographie ihnen Dauer schenkte, erhielten sie sich also gar nicht über die bloße Zeit hinaus, vielmehr – die Zeit schüfe aus ihnen sich Bilder.
Das Wort geht mir nach: „Sie lachen und zugleich überläuft sie ein Grausen.“ Ein paar Seiten weiter folgt eine ähnliche Beobachtung:
Als die Großmutter vor dem Objektiv stand, war sie für eine Sekunde in dem Raumkontinuum zugegen, das dem Objektiv sich darbot. Verewigt worden ist aber statt der Großmutter jener Aspekt. [Welcher, bleibt hier unzitiert, siehe unten. JR] Es fröstelt den Betrachter alter Photographien. Denn sie veranschaulichen nicht die Erkenntnis des Originals, sondern die räumliche Konfiguration eines Augenblicks; nicht der Mensch tritt in seiner Photographie heraus, sondern die Summe dessen, was von ihm abzuziehen ist.
In diesen Sätzen steckt für mein Empfinden mehr Realität als in dem ganzen Photo-Buch von Roland Barthes („Die helle Kammer. Bemerkungen zur Photographie“ 1980). Auch der folgende:
Die aktuelle Photographie, die eine dem gegenwärtigen Bewußtsein vertraute Erscheinung abbildet, gewährt in begrenztem Umfang dem Leben des Originals Einlaß. Sie verzeichnet jeweils eine Äußerlichkeit, die zur Zeit ihrer Herrschaft ein so allgemein verständliches Ausdrucksmittel ist wie die Sprache. (S.29)
In diesem Fall bezieht sich Kracauer auf eine Filmdiva seiner Zeit, was sich aber leicht transponieren lässt. Weiter mit Blick auf die Großmutter (mit Blick auf das zweite Foto oben könnte ich auch sagen: der Junge da oben – scheinbar jung -, bin doch ich gewesen, heute fast 25 Jahre älter als mein Vater damals, als er noch 7 Jahre zu leben hatte):
Das Gespenst ist komisch und furchtbar zugleich. Nicht das Lachen nur antwortet der veralteten Photographie. Sie stellt das schlechthin Vergangene dar, aber der Abfall war einmal Gegenwart. Die Großmutter ist ein Mensch gewesen, und zu dem Menschen haben Chignons und Korsett, hat der hohe Renaissance-Stuhl mit den gedrehten Säulen gehört. Ein Ballast, der nicht niederzog, sondern bedenkenlos mitgenommen wurde. Nun geistert das Bild wie die Schloßfrau durch die Gegenwart. Nur an Orten, an denen eine schlimme Tat begangen worden ist, gehen Spukerscheinungen um. Die Photographie wird zum Gespenst, weil die Kostümpuppe gelebt hat. Durch das Bild ist bewiesen, daß die fremden Attrappen als ein selbstverständlicher Zubehör in das Leben einbezogen worden sind. Sie, deren mangelnde Transparenz auf der alten Photographie erfahren wird, haben sich mit den durchsichtigen Zügen früher unzertrennlich gemischt. Die schlimme Verbindung, die in der Photographie andauert, erweckt den Schauder. (…) Auch die Wiedergabe alter Schlager oder die Lektüre einst geschriebener Briefe beschwört wie das photographische Bildnis die zerfallene Einheit neu herauf. Die gespenstische Realität ist unerlöst. Sie besteht aus Teilen im Raum, deren Zusammenhang so wenig notwendig ist, daß man sich die Teile auch anders angeordnet denken könnte. Das hat einmal an uns gehaftet wie unsere Haut, und so haftet unser Eigentum noch heute uns an. Wir sind in nichts enthalten, und die Photographie sammelt Fragmente um ein Nichts. Als die Großmutter vor dem Objektiv stand, war sie für eine Sekunde in dem Raumkontinuum zugegen, das dem Objektiv sich anbot. Es fröstelt den Betrachter alter Photographien. Denn sie veranschaulichen nicht die Erkenntnis des Originals, sondern die räumliche Konfiguration eines Augenblicks; nicht der Mensch tritt in seiner Photographie heraus, sondern die Summe dessen, was von ihm abzuziehen ist.
Quelle Siegfried Kracauer: „Die Photographie“ (Seite 21 bis 40) in: „Das Ornament der Masse“ / Essays / suhrkamp taschenbuch Frankfurt am Main 1977 (1963)
Ein altes Foto, das nicht traurig macht (sondern?), aus dem Album meiner Mutter: